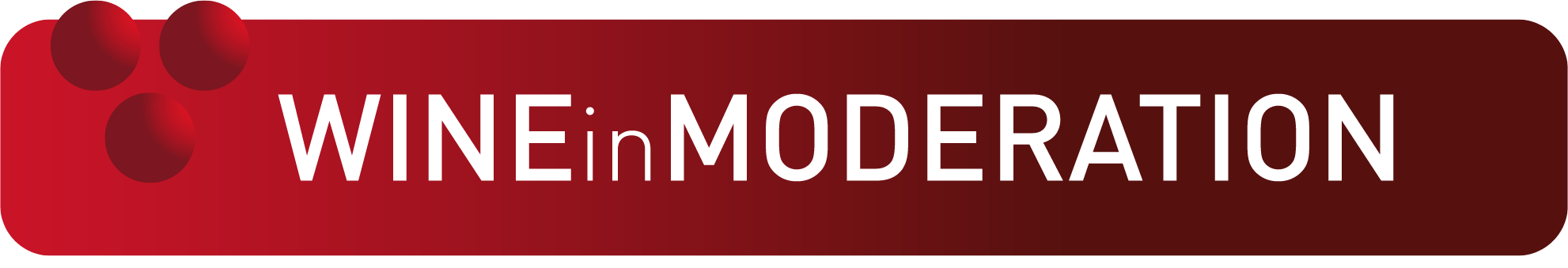Buchbesprechungen
Wir veröffentlichen regelmäßig Rezensionen von Büchern und anderen Veröffentlichungen der Weinkultur und Weingeschichte. Wenn Sie Anregungen für Besprechungen haben, wenden Sie sich gerne an uns!
Hinweise zum Durchsuchen der Buchbesprechungen:
- Um nach Namen oder Titeln zu suchen, nutzen Sie bitte die Filtersuche unten:
Sie durchsucht alle Einträge in der Liste. - Um den gesamten Text aller Buchbesprechungen zu durchsuchen, nutzen Sie bitte die Volltextsuche im dunkelgrünen Feld rechts oben. Hier können Sie nach beliebigen Stichworten suchen.
Rathke, Winfried: Wein – Mythos – Kunst. Menippos Verlag 2023, 164 Seiten; ISBN 9783000753275. 15,80 Euro. 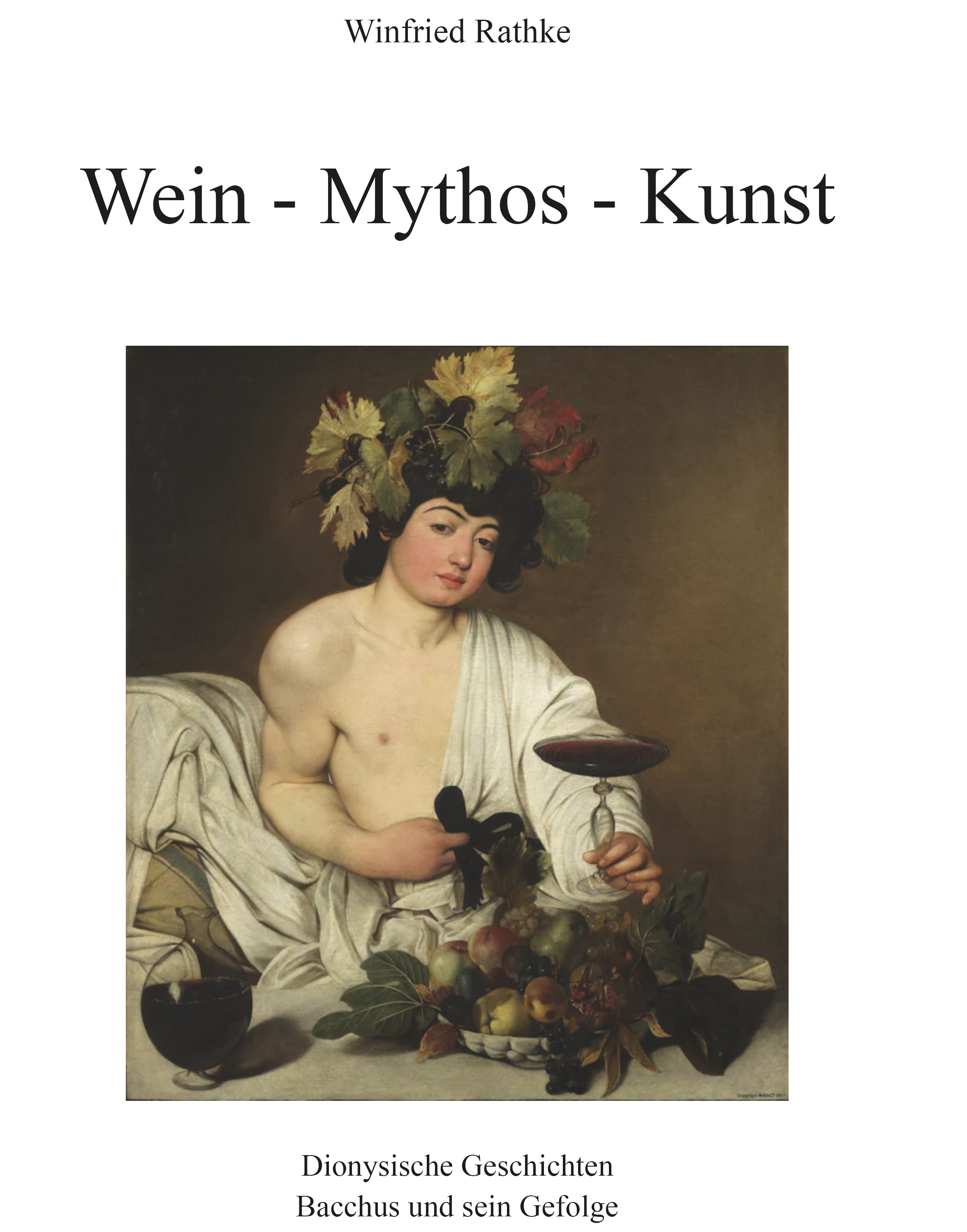
Rathke, Augenarzt, Tropenmediziner, Lyriker, Gitarrist und Hobby-Historiker, lebt seit 1965 im Rheingau. Nun hat er all seine Erfahrungen, sein Wissen rund um den Wein und seine Leidenschaft für die Kunst in ein Buch gepackt. Es umfasst acht Schwerpunkte: Dionysos – Bacchus, Alter Orient, Dionysos in Hellas, Weingefäße, Personal des Dionysos, Feste, Das Theater sowie Bibel und Wein.
Dass der Wein in der griechischen und römischen Mythologie eine große Rolle spielte, dürfte hinlänglich bekannt sein. Wie aber was mit wem und wodurch zusammenhängt, vielleicht weniger. Untermalt von wunderbaren Bildern aus der weltweiten Museenlandschaft entführt Rathke die Leserschaft in die griechische Götterwelt. Seine augenzwinkernden Kommentare lassen die Bilder von Rubens sowie von Reni und Franz von Stuck lebendig werden. In vielen Bildern, Abbildungen von Mosaiken, Statuen, Reliefs oder Fresken wird die Geschichte des Weingotts erzählt. Der Nahe Osten ist heute religionsbedingt eher abstinent, früher sah das ganz anders aus. Zwischen Euphrat und Tigris war Wein alltäglich. Auch hier belegen zahlreiche Abbildungen, dass in Armenien und Jordanien schon in frühester Zeit Weinbau betrieben wurde. Nicht nur skurrile Trinkgefäße, wie z. B. eine Brustwarzenkanne oder eine Weinkanne mit Greifenkopf, weinspezifische Buchmalerei und Keramikfliesen im Topkapi-Palast zeugen vom hohen Stellenwert des Weines in dieser Region.
Im nächsten Kapitel wird es ein wenig wissenschaftlich. Man erfährt nebenbei, woher der bakteriologische Begriff Staphylokokken kommt und wer der Ampelographie ihren Namen gegeben hat. In Kommentaren zu Bildern von Velasquez wird man aufgeklärt, woher der Ausdruck „homerisches Gelächter“ kommt. Des Weiteren belegen zahlreiche Bilder von Rubens, wie feuchtfröhlich es im Götterhimmel zuging. Einen breiten Raum nehmen die Gefäße ein, in denen Wein aufbewahrt oder aus denen Wein getrunken wurde. Vom einfachen Trinkschlauch aus Ziegenleder über Trinkhörner und kunstvollen Schalen bis hin zu Amphoren und letztlich zum Weinfass. Auch dies wird wieder mit zahlreichen Bildern belegt und mit witzigen Randbemerkungen kommentiert. Wem ist z. B. bekannt, dass es ein Weingefäß namens „Krater“ gibt, dieses 1.100 Liter fassen kann, 1,64 m groß ist, 208 kg wiegt und in einem keltischen Grab gefunden wurde? Da in der Kunst fast alles erlaubt ist, störte man sich auch nicht daran, aus einem bemalten Weingefäß zu trinken auf dem ein Mann abgebildet ist, der auf seinem Penis eine Trinkschale balanciert. Viele solcher Kuriositäten lassen einen staunen und verwundert mit dem Kopf schütteln.
Viele nackte Wahrheiten erwarten die Leser im folgenden Kapitel, in dem es um das Personal von Dionysos und die meist ausufernden Bacchanale geht. Nymphen, Satyre, Putten, Eroten, Faune sowie betrunkene Silene in allen möglichen Situationen werden dargestellt. Wein- und Fleischeslust von Rubens und seinen Kollegen phantastisch ins Bild gesetzt. In unzähligen Stellen, so erfährt der Leser im letzten Kapitel, findet der Wein in der Bibel Erwähnung. In diesem Büchlein wird dies durch wunderbare Geschichten und Bilder dokumentiert. Ob Noahs Trunkenheit, die Geschichte von Lot und seinen Töchtern, die Hochzeit von Kana oder das wohl berühmteste Beispiel, das Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern, in dem der Wein neben dem Brot letztlich als symbolisches Bindeglied zwischen Mensch und Gott versinnbildlicht wurde. Daneben zeigen viele Gemälde wie „Christus in der Kelter“ oder „Maria mit dem Kinde und der Weintraube“ u. v. a. den Stellenwert des Weins im Christentum.
Ich habe dieses Büchlein mit Lust verschlungen und konnte es kaum erwarten, die Seiten umzublättern. Diese Mischung aus umfassendem, aussagekräftigem Bildmaterial, humorigen Bemerkungen und geschichtsträchtigen Texten ist einfach genial. Wein einmal ganz anders. Pralles Leben, tiefe Sinnlichkeit. Die Würdigung des Weins als eines der schönsten Kulturgüter der Menschheit. Dieser Streifzug in die griechische Mythologie, durch die berühmtesten Museen der Welt, zu antiken Stätten ist interessant, lehr- und aufschlussreich. Eine mehr als amüsante Geschichts- und Kulturstunde. Ein Lesespaß, egal ob mit oder ohne Wein.
Horst Kröber, Kippenheim
Patzwahl, Wolfgang: Wassermanagement und Bewässerung im Weinbau. Eugen Ulmer Verlag 2023, 190 Seiten. ISBN 978-3-8186-1271-9. 24,95 Euro. 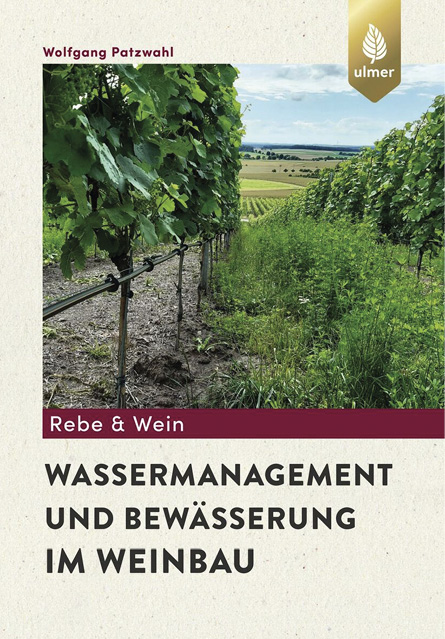
Kein anderes Thema brennt den Winzerinnen und Winzern in den letzten Jahren so unter den Nägeln: Mal gibt es Extremniederschläge und Überflutungen, dann wieder anhaltende Trockenheit – das Wassermanagement ist zur vielleicht größten Herausforderung des Weinbaus in unseren Breiten geworden. Wolfgang Patzwahl, ein erfahrener Weinbauexperte und Berater, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik und hat dazu auf vielen Tagungen referiert. Sein fundiertes Wissen hat er nun (erneut) in einem Buch niedergelegt. Übrigens hatte Gerhard Stumm vor 15 Jahren in der Mitteilung 1/2008 das damalige Buch „Bewässerung im Weinbau“ von Patzwahl lobend besprochen.
Im ersten Kapitel seines neuen Buchs geht Patzwahl zunächst auf die Rahmenbedingungen, sprich auf den Klimawandel und seine Folgen für den Weinbau sowie auf Anpassungsmöglichkeiten der Winzerinnen und Winzer ein. Als wichtige Klimaparameter werden Temperatur und Niederschlag erörtert. Intensiv schildert Patzwahl die Auswirkungen des Klimawandels auf Rebanlage und Wein: er präsentiert in Wort und Bild, in Tabellen und Fotos erkennbare Folgen für die physiologische Entwicklung der Rebe, für die Ertragsleistung, auf das Bodengefüge und Wasserhaltefähigkeit und zieht Hagel und Spätfröste in seine Analysen mit ein. Er zeigt die begrenzten Möglichkeiten der Anpassung auf den Klimawandel auf, unter anderem durch Sortenwechsel, Verlegung von Rebflächen, durch Einsatz von Bewässerung und anderes mehr.
Im zweiten Kapitel beschäftigt er sich dann mit den pflanzenbaulichen Grundlagen, also mit der Funktion des Wassers in der Pflanze, mit den Einflussfaktoren auf den Wasserhaushalt der Rebe sowie mit dem Wasserhaushalt in den Weinbergsböden und im gesamten Weinbergssystem. Was passiert in den Reben bei zunehmender Trockenheit? Wie reagiert die Pflanze darauf, wie kann der Winzer/die Winzerin in das komplexe System eingreifen? Im Hauptteil des Buches beschäftigt sich Patzwahl natürlich mit der Ausgestaltung des Wassermanagements von pflanzenbaulichen Maßnahmen, mit Bewässerungstechnik, Wasserbeschaffung und mit den Beziehungen zwischen Weinqualität und Bewässerung. Um nur einige Stichworte zu nennen: Wasserpotenzial, Wurzelhaarzone, Quantität und Qualität der Proteinbiosynthese, Kohlenhydratstoffwechsel, Anfälligkeit für Pilzinfektionen, Reservestoffeinlagerung und Frostresistenz. Es geht um die Einflussfaktoren auf den Wasserhaushalt der Rebe, um Reaktionsmuster von Reben bei Wasserverknappung und um den Einfluss von Bodenpflege und Begrünung. Die Betrachtungen drehen sich um das Wasser im Boden und um den Wasserhaushalt im System Weinberg. In weiteren Kapiteln geht es um das Wassermanagement im Weinbau, um zu empfehlende pflanzenbauliche Maßnahmen, um Bewässerungstechnik, um quantitative und qualitative Anforderungen an Bewässerungswasser sowie um den Zusammenhang zwischen Bewässerung und Weinqualität. Das Spektrum der aktuellen Fragen wird an den Themen der weiteren Kapitel deutlich: Bewässerung und Düngung, Bewässerung zur Frostabwehr, Planung von Bewässerungsanlagen, Arbeitsaufwand, Kosten und Effizienz sowie ökologische Aspekte.
Das Buch ist fachlich fundiert und zudem in einer gut lesbaren Art und Weise geschrieben. Es ist gut strukturiert, reich illustriert (31 Farbfotos, 46 Zeichnungen und 31 Tabellen), umgesetzt mit einer ansprechenden Graphik. Lobend zu erwähnen ist auch ein umfassendes Literaturverzeichnis und ein umfangreiches Sachregister. Kurzum: ein hochaktuelles und sehr empfehlenswertes Buch!
Rudolf Nickenig, Remagen
Lucand, Christophe: Le Vin des Nazis. Verlag Dunod, 336 Seiten. EAN / ISBN 978-2-10085-233-8. ca. 20,00 Euro. 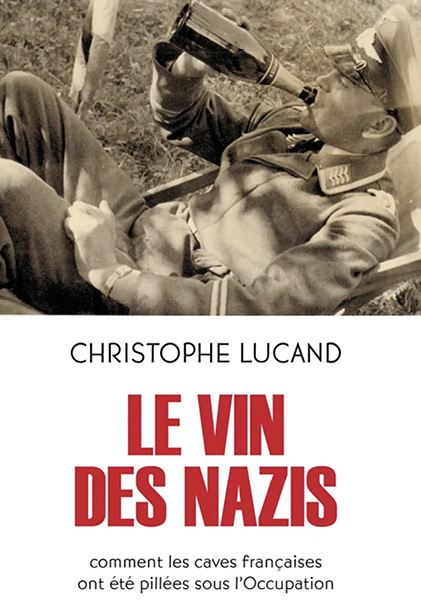
In seinem jüngsten Buch kommt Christoph Lucand wieder auf die Jahre 1940–44 und die Okkupation Frankreichs zurück, der er bereits 2017 eine Veröffentlichung gewidmet hatte. Der promovierte Historiker gehört in Frankreich zu den anerkannten Fachleuten auf diesem Gebiet, bekannt für akribische Auswertung von Archivmaterial. Das Cover-Photo eines aus der Flasche saufenden Soldaten und der Titel „Der Wein der Nazis“ führen in die Irre. Es geht gerade nicht um die Plünderung Frankreichs durch den Besatzer, sondern um die lukrativen Weingeschäfte französischer Kollaborateure und ihrer deutschen Partner.
So bizarr es erscheint: für die von Überproduktion geplagte Weinwelt Frankreichs war die Okkupation, rein kommerziell, erst einmal ein Segen. Goldgräberstimmung machte sich breit. Neue Akteure traten auf, denen die neu geschaffenen A.O.C.-Regelungen in die Hände spielten. Der eigentlich gut eingespielte Weinhandel kam ins Schwanken und es wurden für die französischen Weinregionen bevollmächtigte „Weinführer“ eingesetzt. Auch wenn Lucand es nicht thematisiert, so zeigen ihre Biographien, dass da ein eingespieltes Team am Werk war. Die „Weinführer“ waren absolut keine Unbekannten in Frankreich. Man arbeitete lange, oft schon seit Generationen zusammen. Die neue Situation war kein Bruch, sondern die Fortsetzung der guten Kooperation unter noch besseren Bedingungen. Auch die „Stunde Null“ am Ende der Besatzungszeit fällt aus. Man lud sich noch einmal zum Essen ein, verabschiedete sich freundlich und freute sich auf die baldige Wiederaufnahme der Geschäfte.
Kein Index hilft, den Überblick über die Fülle an Personen zu behalten, die der Text einführt – umso bedauerlicher, als der Leser auch nicht auf das Lexikon der „Persönlichkeiten der Weinkultur“ der GGW zählen kann: die deutschen Hauptakteure wie z. B. Joachim von Ribbentrop (im Nebenberuf Weinhändler, Deutschland-Vertrieb für Champagner Mumm und Pommery, Schwiegersohn von Otto Henkell), Otto Kläbisch (Generalagent von Lanson, Martell und Dubonnet, Geschäftsführer von Matheus Müller in Eltville, Schwager von Ribbentrop, Weinführer Champagne), sein Bruder Gustav Kläbisch (Weinführer Charente, wo die Familie eine Firma besaß), Friedrich Dörrer aus München und sein Nachfolger Adolph III Segnitz (Weinführer Burgund, Rhône, Provence), Heinz Bömers (Besitzer verschiedener Firmen in Deutschland und Frankreich, darunter Reidemeister & Ulrichs in Bremen, Weinführer Bordeaux) sind dort (noch) nicht zu finden.
Lucand zeichnet die Beziehungen der Besatzer zu den Konsumenten in den besten Kreisen der französischen Gesellschaft nach, aber auch den Weg der Massenware. Schließlich zeigt er, wie französischer Wein von einem begehrten Getränk zu einem strategischen Rohstoff der Kriegswirtschaft wurde und sogar destilliert im Antrieb von V1 und V2 landete. Der nationalsozialistische Durst nach Wein wird so eindrücklich geschildert, dass man glauben möchte, Deutschland sei ein Land ohne Wein. Der Stil des Werkes ist etwas pathetisch. Ein wohlwollendes Lektorat hätte hier Gutes tun können. Manche Stilmittel, die den Textfluss wohl lebendig machen sollen, wirken deplatziert. Die Charakterisierung deutscher Nazigrößen bleibt in Karikaturen und an Äußerlichkeiten hängen, die dem Verständnis nicht helfen – und gerade dem französischen Leser sicher nicht geholfen haben.
Nach der Lektüre bleibt der Eindruck, dass es sich eher um einen Ergänzungsband des 2017 erschienenen „Le Vin et la Guerre“ handelt, als um ein eigenständiges Werk. Dem Interessenten für diese Thematik sei hiermit nicht dieses, sondern beide Bücher empfohlen. Leider liegen die Arbeiten von Christophe Lucand bisher in englisch und japanisch, aber nicht in deutscher Sprache vor, was angesichts ihrer Bedeutung für die deutsch-französische (Wein-)Geschichte nicht nachzuvollziehen ist.
Den größten Gewinn aus diesen beiden Werken werden Forschende ziehen, die sich dem Thema in einer deutschen, deutsch-französischen oder europäischen Perspektive nähern. Allein die Auflistung der Aktenbestände und die Bibliographie geben so einem Projekt eine wertvolle Starthilfe.
Literatur:
Lucand, Christophe, Le Vin des Nazis. Collection Essais Français, Grasset, Paris 2023, 325 Seiten.
Lucand, Christophe, Le vin et la guerre. Comment les nazis ont fait main basse sur le vignoble français, Paris, Armand Colin, 2017, 448 Seiten.
Karoline Knoth, Meursault
Küsters, Ernst: Mit Rotwein gegen Krebs – Wie die richtigen
Naturstoffe helfen. BoD – Books on Demand 2023, 286 Seiten. ISBN: 978-3-74481-660-1. 14,40 Euro.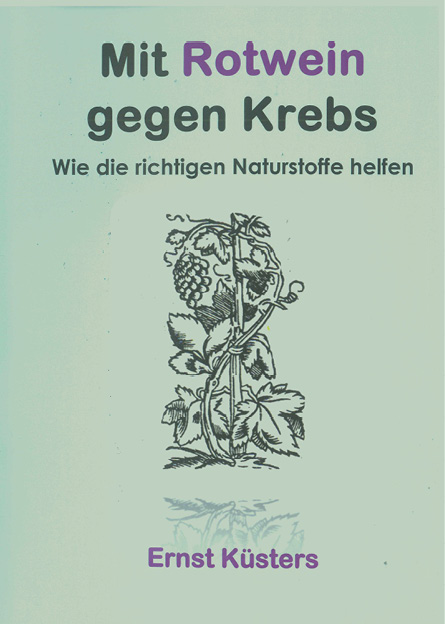
„Mit Rotwein gegen Krebs“ ist ein medizinisch-ernährungswissenschaftliches Fach- und Sachbuch über die antikanzerogenen Wirkstoffe im Wein. Es werden die wichtigsten Einzelstoffe und ihr pharmakologisches Potential kurzweilig vorgestellt und durch ein ausführliches Quellenverzeichnis gestützt. Der Leser sollte allerdings biologisch vorgebildet sein, um alles verstehen zu können.
Man merkt, dass der Autor über viele Jahre (1984–2020) Krebsmedikamente in der Pharmaindustrie miterforscht hat. Küsters stellt zu Beginn sachkundig und biochemisch umfassend die grundlegenden Mechanismen der Entstehung von Krebs dar. Dabei verweist er zunächst auf das diesbezüglich unterschätzte Zuckerabbauprodukt Methylglyoxal, das als mutagen und cancerogen gilt und fordert weniger Zucker – und mehr Rotwein – in unserer Nahrung. Dass das Überangebot an Zucker für viele Erkrankungen, einschließlich bestimmter Krebsarten verantwortlich gemacht wird, ist mittlerweile unumstritten.
Wein ist mehr als Alkohol. So gibt es über Säuren, wie Weinsäure, Gallussäure, Vanillinsäure, Kaffeesäure in der Tat gute Studien, die die Biochemie der Wirkung erklären. Ebenso werden die Polyphenole, wie Catechine und glykosilierte Flavonoide, wie das Malvidin, als bekannt antikanzerogen erwähnt.
Schwerpunkte des Autors sind die Polyphenole, allen voran das Resveratrol. Von ihm weiß man schon lange, dass es antikanzerogen und lebensverlängernd wirkt. Allerdings ist kritisch zu hinterfragen, wie viele Liter Wein man trinken müsste, aber wegen des Alkohols nicht sollte, um die pharmakologische Wirkung zu erzielen. Zwar gibt es die beschriebenen Wirkungen, die Frage ist, ob sie beim moderaten Konsum relevant sind.
Auf das Mengenproblem weist auch Küsters hin, nämlich dass das Resveratrol im „durchschnittlichen“ Wein nicht ausreicht und wirft daher die Frage auf, ob bestimmte Rebsorten unter diesem Aspekt empfehlenswert seien. Er konzentriert sich insbesondere auf Piwis als „richtigen“ Rotwein oder denkt sogar über „Kunstweine“ mit optimierter Zusammensetzung. Diese Überlegungen sind doch sehr problematisch. Natürlich findet man in Piwis, wie Regent oder Cabernet cortis, eine höhere Konzentration an Catechinen, Resveratrol oder Kaftarsäure, die allesamt als pharmakologisch wirksam gelten. Aber die Konzentration auf den „optimalen“ Wein (als Arzneimittel) ist nicht der richtige Ansatz für ein landwirtschaftliches Erzeugnis und Kulturgut. Vor allem sind derartige Ansätze im heutigen gesellschaftspolitischen Umfeld nicht kommunizierbar.
Der eigentliche Schwachpunkt: Küsters geht kaum auf kanzerogene Wirkungen des Alkohols per se bzw. dessen Oxidationsprodukt, auf das Acetaldehyd, ein. Diese Wirkungen sind wissenschaftlich ziemlich gut belegt und müssen sehr detailliert betrachtet und bewertet werden. Und es ist auch nicht zu übersehen, dass Alkohol im Wein um ein Vielfaches mehr vorkommt als die anderen Inhaltsstoffe. Die Summe der Einzelfaktoren ist eben doch was anderes als das Ganze. Kritisch ist auch anzumerken, dass der Titel nicht besonders glücklich gewählt ist – vor allem im Hinblick auf die alkoholpolitischen Gesamtwetterlage. „Wein als Medikament“ weckt negative Assoziationen und wird weder der Thematik noch der wissenschaftlichen Kompetenz des Autors gerecht. Denn unabhängig von den genannten Einschränkungen weist Küsters eine große Fachkenntnis auf, sowohl was die Inhaltsstoffe des Weines und ihr Potential anbelangen als auch Weinkenntnisse im Allgemeinen. Und deshalb lesenswert. Geschmack und Genuss – die eigentlichen Intentionen, Wein zu trinken – bleiben aber m. E. auf der Strecke.
Claudia Hammer, Oberwesel
Junglas, Wolfgang: Weinorte im Rheingau/Entdecken – Entspannen – Entkorken. Droste Verlag, Düsseldorf 2023. Paperback, 168 Seiten; ISBN 978-3-7700-2422-3. 16,00 Euro. 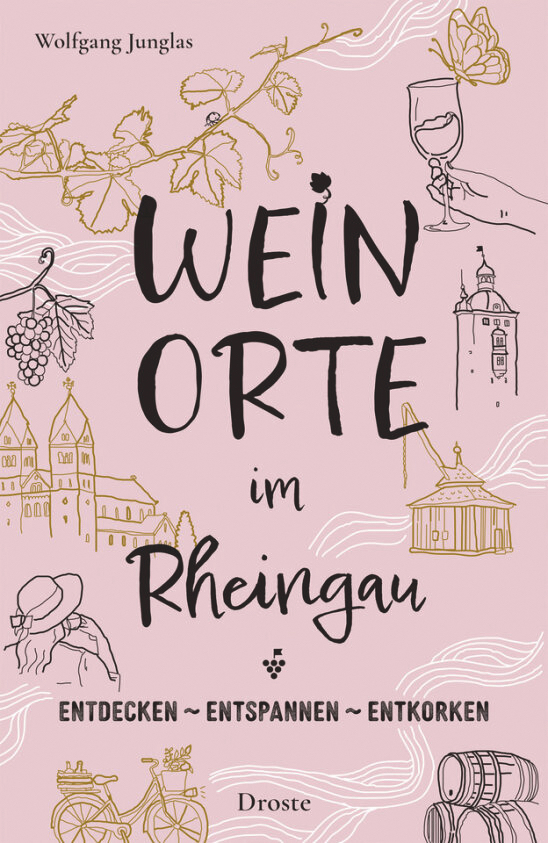
Die Gesellschaft für Geschichte des Weines plant, ihre Frühjahrstagung 2025 im Rheingau zu veranstalten. Wer sich rechtzeitig darauf vorbereiten will, dem sei dieses Buch des bekannten Fernsehschaffenden empfohlen. Der Autor ist im Rheingau zu Hause und wohnt mit seiner Familie direkt an den Weinbergen. Um die kümmert er sich als Präsident der Deutschen Weinpublizisten (Weinfeder e.V.) und der internationalen Weinjournalisten (FIJEV) auch beruflich. Er veröffentlichte bereits zahlreiche Gastronomieführer und produzierte bekannte TV-Sendungen wie „Johann Lafer kocht“ oder die „Wahl der deutschen Weinkönigin“.
Der gebürtige Eifelaner ist überzeugt: im Rheingau lässt es sich gut leben. Und dafür führt er in seinem Buch viele Argumente an. Er verfolgt dabei ein überzeugendes journalistisches und verlegerisches Konzept: Er stellt 76 „Weinorte“ vor, kurz, knapp und unterhaltsam auf einer Druckseite beschrieben, dazu jeweils ein ganzseitiges attraktives Foto. Auffallend, dass der Autor mit der Formulierung der Überschriften sehr stark auf weinkulturelle und weingeschichtliche Aspekte setzt: „Schlenderweinprobe im Kloster“ (Kloster Eberbach in Eltville), „Romantik pur erleben“ (Das historische Brentano-Haus in Winkel), „Riesenfass im Kunstkeller“ (Weingut Georg Müller Stiftung in Hattenheim), „Straußwirtschaft wie früher“ (Weingut Hanka in Johannisberg), „Weinkultur im besten Sinne“ (Keller & Kunst Kontor in Kiedrich), die Reihe an weinkulturhistorischen Aufhängern, die Junglas bedient, um seine Lieblingsorte anzupreisen, ließe sich fortsetzen.
Da Junglas zeigen will, dass sich im Rheingau gut leben lässt, kommt er an Empfehlungen für Weinrestaurants nicht vorbei. Das Spektrum ist groß: „Piratenbude am Fluss“ (Beachrestaurant Allendorf am Rhein), „Steinhaus für Gourmets“ (Das Graue Haus in Winkel), „Weinrestaurant klassisch“ (Restaurant zum Krug in Hattenheim) bis zu „Buntes Genussland“ (Y Wine & Kitchen in Eltville).
Der Autor zielt aber bewusst auch auf junge Weinfreunde, wenn er zum Beispiel folgende Empfehlungen gibt: „Chillen im Liegestuhl“ (Weinstrand Rüdesheim), „Kuscheln im Fass“ (Übernachten im Rheingau 524 in Geisenheim), „Jung und kreativ“ (Weingut Jung-Dahlen in Erbach). Natürlich dürfen touristische Empfehlungen nicht fehlen: „Weinwandern im Welterbe (Wander-Guru Wolfgang Blum), „Winzerhof für Wohnmobile“ (Weinhof Martin in Erbach), „Immer der Flasche nach“ (Flötenwanderweg in Oestrich), „Unterwegs zu Weinmühlen“ (Mühlenwanderweg im Elsterbachtal), „Auf zum Pfiffchenlauf!“ (Rheingausport in Oestrich), usw.
Natürlich beschäftigt sich Junglas nicht nur mit Wein, auch der Sekt kommt nicht zu kurz: „Hier prickelt der Rheingau“ (Sekt- und Weinkellerei Reuter & Sturm), „Prickelndes Weinhotel“ (Wein- und Sekthaus F. B. Schönleber in Mittelheim), „Oranger Sekt-Adel“ (Sektmanufaktur Schloss Vaux in Eltville), „Sektprobe über den Dächern“ (Bachmanns Wein+Kultur in Eltville), „Winzersekt aus Erster Lage“ (Wein- und Sektgut in Hattenheim).
Junglas entführt die Leser zu den unterschiedlichsten Weinorten, bunt gemischt und immer wieder überraschend: alle bekannten Weingüter, Klöster und Schlösser, aber auch Neueinsteiger, Gutsausschänke und Restaurants, Übernachtungsangebote, Weinprobiermöglichkeiten, farbige Weinerlebniswelten, Wanderempfehlungen, schönste Weinsichten, Weinfeste, Beratungsangebote, Wissenschaft, Nobles, Stylisches, Hippes, Traditionelles, bewährte und moderne Veranstaltungen. Ein kurzweiliges Brevier. Sehr zu empfehlen (insbesondere, Sie wissen schon, als Vorbereitung für die Frühjahrstagung 2025!).
Rudolf Nickenig, Remagen