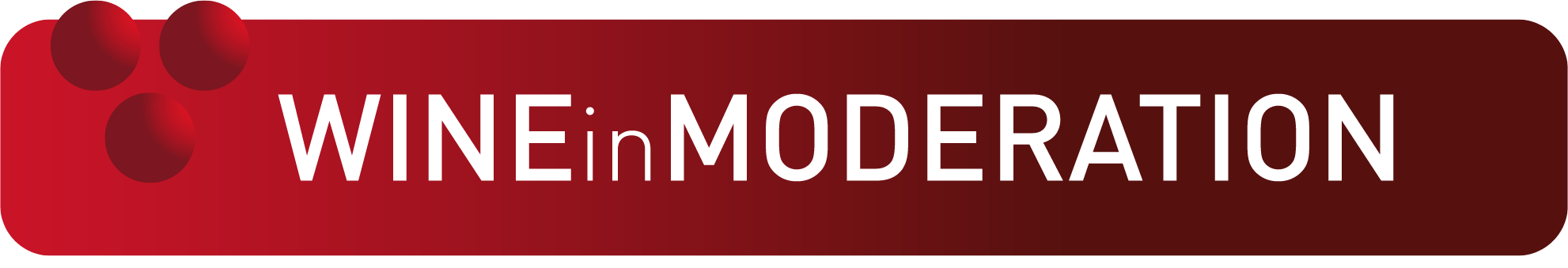- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Hamatschek, Jochen: Tödliches Gas – ein Weinkrimi. Verlag BoD. Books on Demand GmbH 2024. 217 Seiten; ISBN 978-3-7597-7626-6. 10,99 Euro, E-Book 7,49 Euro.
 Der vorliegende Weinkrimi ist mehr als nur ein Weinkrimi. Er führt den Leser auf der ersten Hälfte des Inhalts präzise, verständlich und anschaulich in die Herstellung des Weines, in Weinbereitung, sehr ausführlich in die Weinansprache, Weinfehler, weinrechtliche Fragen und Weinmarketing ein. Das kann nur das Werk eines Spezialisten sein, der alle Feinheiten seines Metiers beherrscht und hier weitergibt.
Der vorliegende Weinkrimi ist mehr als nur ein Weinkrimi. Er führt den Leser auf der ersten Hälfte des Inhalts präzise, verständlich und anschaulich in die Herstellung des Weines, in Weinbereitung, sehr ausführlich in die Weinansprache, Weinfehler, weinrechtliche Fragen und Weinmarketing ein. Das kann nur das Werk eines Spezialisten sein, der alle Feinheiten seines Metiers beherrscht und hier weitergibt.
Der Inhalt des Weinkrimis wird zunächst von Themen der Weinherstellung dominiert, garniert mit mehreren Suiziden, die man zunächst nicht in einem Zusammenhang wähnt. Dadurch und mit immer neuen Vermutungen gelingt es dem Autor, Spannung zu erzeugen und zu erhalten. Erst im letzten, dem 22. Kapitel erfolgt die so nicht erwartete Auflösung.
Der junge Chemiker Daniel, der in einem großen Industrieunternehmen angestellt ist und der vor kurzem seine Frau Kristina, eine junge Germanistin, geheiratet hat, ist traumatisiert vom Selbstmord seiner Frau. Er zieht für eine Übergangszeit in das vor kurzem gekaufte väterliche Schloss-Weingut in Neustadt, um den Vater, der auch noch weitere Interessen hat, zu unterstützen. Dort trifft er auf zwei Personen, die sein weiteres Leben verändern: den kleinwüchsigen, aber sehr versierten Küfer Perkeo, der ihn in die Feinheiten der Weinherstellung und Weinansprache einweiht, und nach einiger Zeit auch auf die IT-affine, flippige Mediendesignerin Essie. Sein Vater hatte ihr den Auftrag erteilt, einen modernen betrieblichen Auftritt, ein neues Design für das Schloss Weingut zu entwickeln. Im Laufe dieses Jahres hört er immer wieder von Selbstmorden in dem Germanistinnen-Milieu, in dem auch seine Frau gelebt hat. Er beauftragt schließlich einen befreundeten Fußballkameraden, der als Kriminalist arbeitet, sowie Essie, mit der er sich inzwischen angefreundet hat, weiter zu recherchieren. Dadurch kommen sie schließlich einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur, das sie jedoch auch in tödliche Gefahr bringt.
Gerhard Stumm, Bad Kreuznach
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Grätzel, Stephan/ Rehm-Grätzel, Patricia: Reiner Wein. Philosophie zum Einschenken. Verlag Königshausen & Neumann Würzburg 2022. 138 Seiten, kartoniert; ISBN: 978-3-8260-7583-4. 17,80 Euro.
 Stephan Grätzel ist emeritierter Professor für Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Patricia Rehm-Grätzel, Docteur des Lettres an der Université de Bourgogne, Dijon, lehrte am Département d’allemand der Université de Bourgogne, an der School of Humanities am Waterford Institute of Technology, Irland, und am Philosophischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Derzeit arbeitet sie als Lehrerin für Deutsch und Französisch am Bischöflichen Willigis-Gymnasium Mainz.
Stephan Grätzel ist emeritierter Professor für Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Patricia Rehm-Grätzel, Docteur des Lettres an der Université de Bourgogne, Dijon, lehrte am Département d’allemand der Université de Bourgogne, an der School of Humanities am Waterford Institute of Technology, Irland, und am Philosophischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Derzeit arbeitet sie als Lehrerin für Deutsch und Französisch am Bischöflichen Willigis-Gymnasium Mainz.
Dem Autorenpaar gelingt es, bereits im Vorwort nicht nur Spannung und mit einem ansprechenden Sprachstil Vorfreude für den Hauptteil aufzubauen, sondern auch die Wahl des Buchtitels ernsthaft und doch vergnüglich zu erklären. Im ersten Kapitel wird die spirituelle Verbindung von Philosophie und Wein behandelt. Die Begegnung mit der Philosophie des Weines von Béla Hamvas macht Lust darauf, mehr über ihn und seine Philosophie zu erfahren. Seine Betrachtungen sind für die Autoren grundlegend und werden im weiteren Verlauf des Buches immer wieder aufgegriffen. Im zweiten Kapitel werden die Reflexionen des Weins, seine Widerspiegelungen der Wahrheit im Leben und Bewusstsein aufgefächert. Hierbei geht es zunächst um die Sinnlichkeit des Weins. Der Wein wird aber auch als Träger von Erinnerungen behandelt. Damit kommen die Autoren zu den Grundfragen des Denkens, der Suche nach dem Grund des Lebens und seinem Sinn. In diesem Kapitel wird gezeigt, warum der Wein in unserer Kultur einen so hohen Stellenwert bekommen konnte. Um ihn und seine Bedeutung ganz zu verstehen, reicht die Betrachtung der Sinnlichkeit, der fünf Sinne nicht aus, sondern es ist – nach Auffassung des Autorenduos – eine Verbindung zum Übersinnlichen erforderlich. Im dritten Kapitel legen sie dar, wie Wein mythologisch, religiös, literarisch und ganz alltäglich gefeiert wurde und wird. Sie stellen den Wein als Protagonisten der Wahrheit auf der Bühne des Lebens dar.
Wem soll ich dieses Buch empfehlen? Ich kann es allen Leserinnen und Lesern ans Herz legen, die bereit sind, die traditionellen Pfade naturwissenschaftlicher und önologischer Weinvorstellungen zu verlassen. Das Autorenpaar nennt das, „Wein neu zu denken“. Hierauf komme ich nochmals zurück. Das Buch ist aber auch deshalb empfehlenswert, weil es in den Kapiteln immer wieder überraschende Gedankenzusammenhänge anbietet, die neugierig machen, über die es sich lohnt nachzudenken oder sich weitere Informationen einzuholen.
Bemerkungen wie „Die Wende vom Selbstverständlichen zum Staunenswertesten ist der Ursprung der Philosophie“ schärfen die Aufmerksamkeit beim Lesen. So auch das nachfolgende Beispiel: „Der Wein teilt also das Schicksal mit dem Geist, auf einen bestimmten Stoff reduziert zu werden: der Wein auf Alkohol, der Geist auf Gehirn. Dabei sind diese sogenannten Stoffe noch nicht einmal ausschlaggebend für das, was sie auch rein stofflich sind: Wein ist kein Alkohol, sondern ein Genuss und Lebensmittel, Geist ist kein Gehirn, sondern der Umgang mit anderen, mit der Natur, auch mit sich selbst.“ Ja, ein Gedankengang, der in der alkoholpolitischen Diskussion von höchster Aktualität ist. Wer mit dem ungarischen Philosophen Béla Hamvas (1897 – 1968) bisher nicht viel anfangen konnte, der wird mit dessen Philosophie des Weins, die in dem Buch eine große Rolle spielt, viel Freude haben. Ein Beispiel: „Die Sinnlichkeit der Welt und der Genuss des Lebens kommen beim Trinken am besten zur Geltung.“ Die Autoren verweisen darauf, dass sich hierbei Hamvas vor allem für den Wein interessiert, „aber nicht nur wegen seiner Qualität, sondern vor allem deshalb, weil er für ihn ‘wie ein flüssiger Kuss’ ist.“ Darüberhinaus gibt Hamvas dem Wein die bedeutende Rolle einer allgemeinen und universalen Stellvertretung des Lebens.
Die Lesefreude wird erhöht durch Passagen wie: die Kneipe gehört „zu den wichtigsten Einrichtungen unserer Zivilisation, denn an diesem Ort werden Wunden geheilt, die dem Menschen in der Öffentlichkeit und durch die Regierung geschlagen werden. [...] Die Kneipe wird hier nicht als der Ort des einsamen Versinkens inmitten vieler Isolierter verstanden und der Wein wird auch nicht nur als ein Getränk oder eine Art Alkohol verstanden, mit dem man sich betäubt. Vielmehr treffen sich hier die Gleichgesinnten, die gemeinsam den Genuss des Lebens feiern.“
In dem Kapitel Wein und Maske gibt es Passagen, die beim Rezensenten doch Zweifel haben aufkommen lassen, ob die Philosophie des ungarischen Philosophen mit seiner Verherrlichung des Rausches, um zur Erleuchtung und damit paradoxerweise „zu einer höheren Nüchternheit“ zu kommen, uns in der heutigen gesellschaftlichen Diskussion Hilfestellung bieten kann. Es gibt auch andere Aussagen in weiteren Kapiteln, denen der Rezensent nicht zustimmen würde, aber sie bieten Gesprächsstoff mit anderen Perspektiven und einem anderen Zugang zur Weinkultur und zur Weinphilosophie. Die Diskussion über ein neues Verständnis von Kultur und Natur wird ebenso aufgegriffen wie die Gratwanderung der Weinbranche auf den Narrativen von Weinphilosophen und der Marketingexperten. In den Kapiteln über die Reflexionen des Weines, bei den Unterkapiteln Poesie des Weines, Architektur des Weins etc. habe ich oft ein Ausrufe- oder auch Fragezeichen (wenn es z. B. um die Heilkräfte geht) an den Rand gesetzt, natürlich nur mit dem Bleistift, zum späteren Wegradieren, denn das Buch soll rein bleiben.
Meine Leseempfehlung wird nicht dadurch gemindert, wenn ich zum Schluss auf eine Passage zurückkomme, der ich nicht zustimmen kann oder von der ich mehr oder eine andere Weiterführung erwartet hätte: „Wein zu denken oder auch neu zu denken bedeutet, ihn auch zu einem Erlebnis werden zu lassen, bei dem die gesamte sinnliche, leibliche und geistig geistliche Symbolik wieder eingebracht wird. D. h. aber auch, den Wein auf alte und wahrscheinliche Weise zu denken. Das neu ist auch eine Rückkehr zur kultischen Bedeutung des Weines und seiner Heiligkeit.“ Auch ich bin der Meinung, dass wir Weinkultur neu denken müssen, aber meines Erachtens nicht mit einem Zurück zur kultischen Bedeutung alter Zeiten. Ich hoffe zumindest nicht, dass der Lebensstil und die Weinkultur der Zukunft kultische Züge einer Vergangenheit tragen, die auch von berauschten Männern und von benachteiligten Frauen geprägt war. Anders gewendet: In einer Zeit, in der uns geradezu fundamentalistische Alkoholgegner unter Berufung auf WHO und DGE die Mär verbreiten, dass bereits der erste Tropfen Wein in jedem Fall gesundheitsschädlich sei, ist das Eintreten für einen aktuellen Weinkulturdiskurs äußerst verdienstvoll. Dem Buch wünsche ich viele Leserinnen und Leser, die bereit sind, Weinkultur neu zu denken und zukunftsweisend zu gestalten.
Rudolf Nickenig, Remagen
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Konsortium Südtirolwein (Hg.): Wein in Südtirol – Geschichte und Gegenwart eines besonderen Weinlandes. Athesia Buch GmbH, Bozen. 520 Seiten; ISBN: 978-88-6839-696-1. 55,00 Euro. Erscheinungsdatum: 13.03.2024. 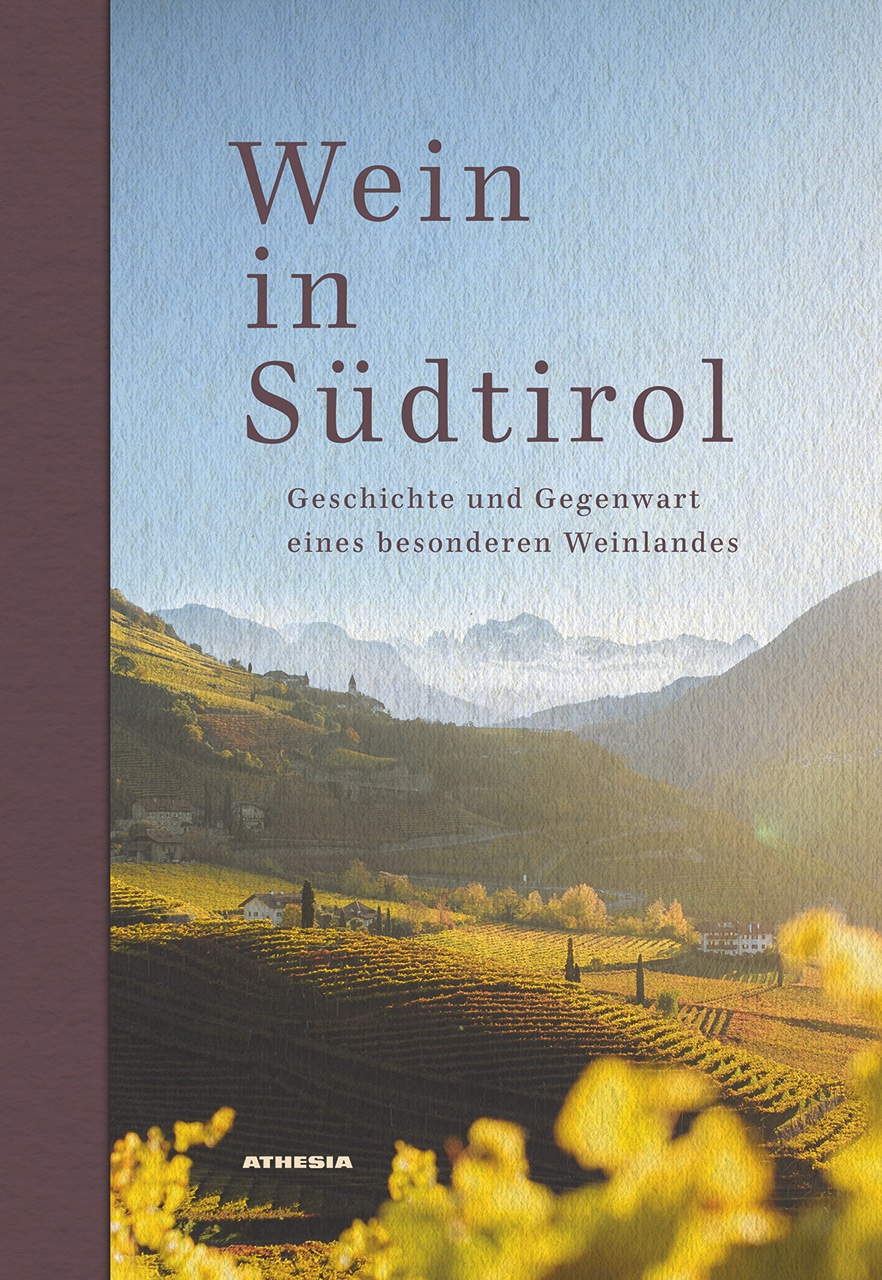
Wer eine Buchrezension schreibt, sollte eine kritische Distanz wahren können. Ich gebe zu, es fällt mir in diesem Fall schwer. Warum? Als junger Generalsekretär war ich sehr häufig in Südtirol, weil wir – die Vertreter deutschsprachiger europäischer Weinbaugebiete – uns regelmäßig in Bozen trafen, um die europäische Weinbaupolitik zu beraten. Nach den intensiven Sitzungen diese einzigartige Weinbauregion erleben zu dürfen, war einfach wunderbar. Warum noch? Die Begeisterung über die Haptik, die Graphik, das Virtuelle dieses Buches. Sie, die potenziellen Leser können es noch nicht nachempfinden, aber wenn Sie die wunderbaren, großformatigen Fotos in diesem Buch gesehen haben, dann wissen Sie, was ich meine. Warum so begeistert? Weil ich zu der Generation Buchliebhaber gehöre und weil ich deshalb ein wenig neidisch werde, dass wir in Deutschland seit vielen Jahren kein derartiges Buch über unsere Weinkultur mehr zustande gebracht haben; während vor wenigen Jahren Österreich es fertiggebracht hat und nun auch Südtirol.
Schauen wir in das Inhaltsverzeichnis: Wir finden fünf große Abschnitte: Erstens das Thema Raum und Natur: Kleines Land, vielfältige Lagen. Zweitens Weinbau im Wandel der Zeit: Lernen und Erfahrung sammeln – 2.500 Jahre lang. Drittens Produktion und Konsumation: Der lange Weg von der Rebe ins Glas. Viertens Der Wein in Kunst, Kultur und Gesellschaft: Mensch und Wein. Fünftens Forschung, Beratung, Verbände: Hier lebt man Wein. Bereits diese Überschriften machen neugierig. Obwohl mich alle Abschnitte ansprechen, schaue ich – mit der Perspektive unserer Gesellschaft – als erstes auf den zweiten Abschnitt: Weinbau im Wandel der Zeit. Ich gehe eine Wette ein, dass unser GGW-Präsident Andreas Otto Weber aufgrund seiner wissenschaftlichen Studienthemen als erstes das Kapitel „Guter Wein aus dem Süden – Weingüter süddeutscher Klöster“ von Josef Nössing lesen wird. Wollen Sie wissen, worauf ich mich stürze? In diesem Abschnitt finden sich drei Beiträge von Helmuth Scartezzini: Spuren aus fast zwei Jahrtausenden – Von den Römern bis ins 18. Jahrhundert; Aufstehen, Krone richten, weitermachen – das für den Weinbau turbulente 19. Jahrhundert; Ein waschechter Bozner – Der St. Magdalener; Ein Weißer im Rotweinland – der Terlaner; Hochalpin bis mediterran – Die Weinbaugebiete Südtirols (gemeinsam mit Monika Unterthurner). Helmut Scartezzini war damals bei unseren weinbaupolitischen Besprechungen als Vertreter Südtirols dabei. Ich hatte seit vielen Jahren nichts mehr von ihm gehört. Ganz im Gegensatz zu Ivo Maran, unserem GGW-Beiratsmitglied, der ebenfalls an mehreren Beiträgen des Buches beteiligt ist: Deutsch? Italienisch? Oder doch ein bisschen von beiden? Einflüsse auf Weinbau und Önologie in einer Grenzregion; außerdem: Vom Massenprodukt zum Charakterwein (Coautor Stefan Morandell); zudem: Erst ausschenken, dann zahlen – der Weinhandel auf den Jakobipreis (mit dem gleichen Coautor); Wie schmeckt der Fortschritt – Erste Weinverkostungen im 19. Jahrhundert (mit dem gleichen Coautor).
Für mich ist das Buch eine Reise in die Vergangenheit, verbunden mit wunderbaren Erinnerungen, aber auch in die Zukunft, denn es macht Lust, den nächsten Südtirol-besuch zu planen. Zum Beispiel nach Mölten in die höchstgelegene Sektkellerei, Josef Reiterer, ein Pionier der handwerklichen Spitzensekte gibt mit seinem Beitrag prickelnde Besonderheit – die Sektproduktion in Südtirol einen Anstoß für dieses Reiseziel. Wein und Sekt, das ist keine rationale, sondern eine hochemotionale Weinkulturgeschichte. Südtirol und dieses Buch sind bestens geeignet, sich diesem Erlebnis hinzugeben. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Autoren auch kritisch die eigene Geschichte analysieren, Tacheles reden bzw. schreiben. So zum Beispiel, wenn Eduard Bernhart von Krisen, Kriege und ein Paradigmenwechsel – Die Weinwirtschaft von 1900 bis heute oder von den Sturen, Querdenkern und Pionieren im biologischen und biodynamischen Anbau schreibt. Die Autoren beherrschen die Kunst, die Leser mitzunehmen, kritisch und emotional, zu letzterem tragen die Fotos aus heutigen und vergangenen Zeiten bei. Man mag es mir nachsehen, dass ich mit besonders großem Interesse im 5. Abschnitt „Hier lebt man Wein – Forschung, Beratung, Verbände“ gestöbert habe und nochmals voller Bewunderung nachgelesen habe, wie die Branche zusammengestanden ist, um das Weinbaugebiet qualitativ nach oben zu führen. Ich kann nicht alle 42 Autoren würdigen, aber zwei Namen müssen doch noch oder nochmals erwähnt werden: Eduard Bernhart, der als Direktor des Weinkonsortiums die Gesamtverantwortung übernommen hatte sowie Christian Rainer, der es als Koordinator fertiggebracht hat, diese große Autorenschaft zu motivieren und zur rechtzeitigen Abgabe ihrer Manuskripte anzuhalten. Einen Sack Flöhe zu hüten, soll eine vergleichsweise einfache Aufgabe sein. Insgesamt ist auf 520 Seiten ein vielfältiges Spektrum des Weinbaugebiets Südtirol entstanden. Anders gewendet – egal, welche Brille man aufhat, für jeden Begeisterten vom Südtiroler Wein und Sekt ist dieses Buch sehr empfehlenswert.
Rudolf Nickenig, Remagen
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Rathke, Winfried: Wein – Mythos – Kunst. Menippos Verlag 2023, 164 Seiten; ISBN 9783000753275. 15,80 Euro. 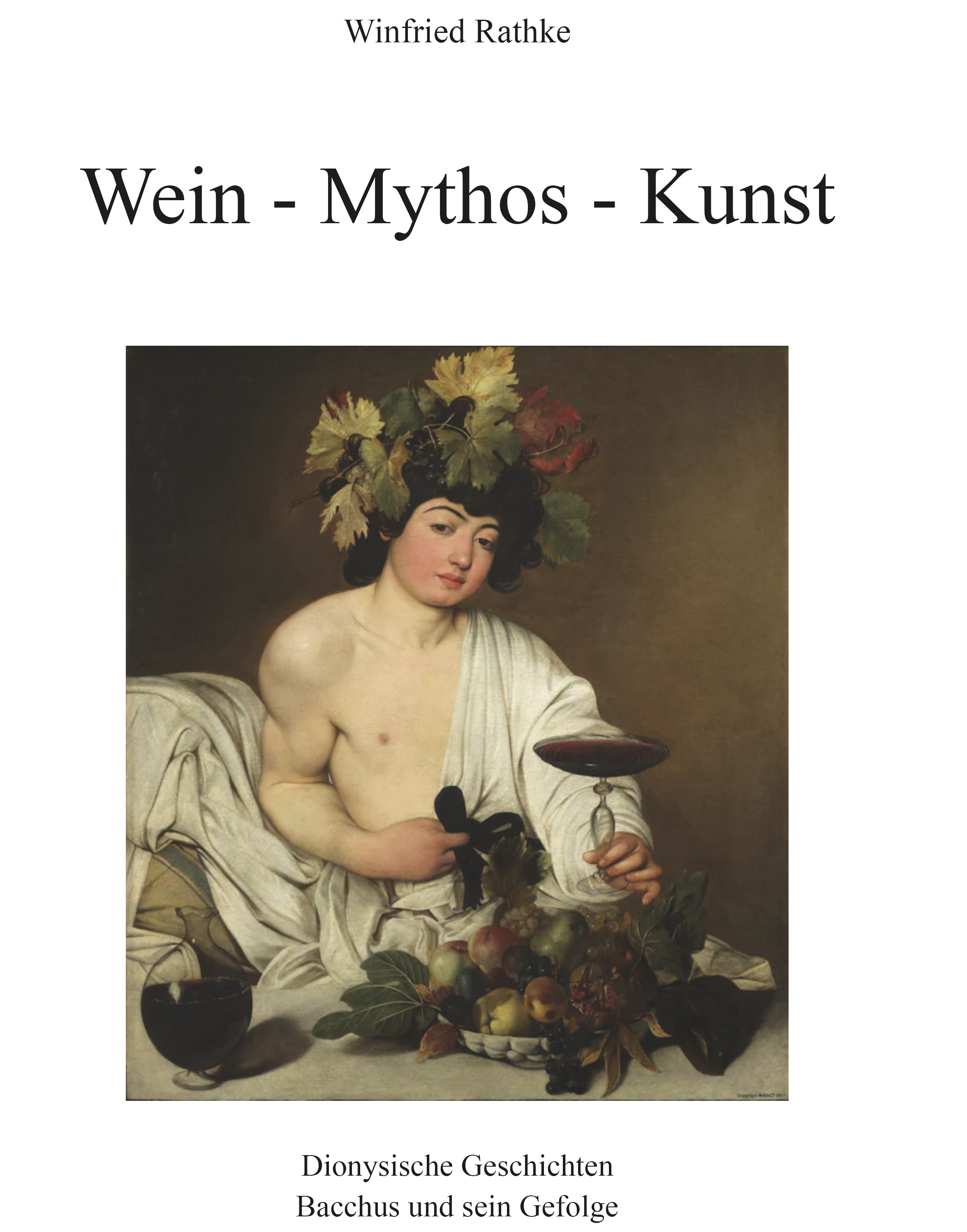
Rathke, Augenarzt, Tropenmediziner, Lyriker, Gitarrist und Hobby-Historiker, lebt seit 1965 im Rheingau. Nun hat er all seine Erfahrungen, sein Wissen rund um den Wein und seine Leidenschaft für die Kunst in ein Buch gepackt. Es umfasst acht Schwerpunkte: Dionysos – Bacchus, Alter Orient, Dionysos in Hellas, Weingefäße, Personal des Dionysos, Feste, Das Theater sowie Bibel und Wein.
Dass der Wein in der griechischen und römischen Mythologie eine große Rolle spielte, dürfte hinlänglich bekannt sein. Wie aber was mit wem und wodurch zusammenhängt, vielleicht weniger. Untermalt von wunderbaren Bildern aus der weltweiten Museenlandschaft entführt Rathke die Leserschaft in die griechische Götterwelt. Seine augenzwinkernden Kommentare lassen die Bilder von Rubens sowie von Reni und Franz von Stuck lebendig werden. In vielen Bildern, Abbildungen von Mosaiken, Statuen, Reliefs oder Fresken wird die Geschichte des Weingotts erzählt. Der Nahe Osten ist heute religionsbedingt eher abstinent, früher sah das ganz anders aus. Zwischen Euphrat und Tigris war Wein alltäglich. Auch hier belegen zahlreiche Abbildungen, dass in Armenien und Jordanien schon in frühester Zeit Weinbau betrieben wurde. Nicht nur skurrile Trinkgefäße, wie z. B. eine Brustwarzenkanne oder eine Weinkanne mit Greifenkopf, weinspezifische Buchmalerei und Keramikfliesen im Topkapi-Palast zeugen vom hohen Stellenwert des Weines in dieser Region.
Im nächsten Kapitel wird es ein wenig wissenschaftlich. Man erfährt nebenbei, woher der bakteriologische Begriff Staphylokokken kommt und wer der Ampelographie ihren Namen gegeben hat. In Kommentaren zu Bildern von Velasquez wird man aufgeklärt, woher der Ausdruck „homerisches Gelächter“ kommt. Des Weiteren belegen zahlreiche Bilder von Rubens, wie feuchtfröhlich es im Götterhimmel zuging. Einen breiten Raum nehmen die Gefäße ein, in denen Wein aufbewahrt oder aus denen Wein getrunken wurde. Vom einfachen Trinkschlauch aus Ziegenleder über Trinkhörner und kunstvollen Schalen bis hin zu Amphoren und letztlich zum Weinfass. Auch dies wird wieder mit zahlreichen Bildern belegt und mit witzigen Randbemerkungen kommentiert. Wem ist z. B. bekannt, dass es ein Weingefäß namens „Krater“ gibt, dieses 1.100 Liter fassen kann, 1,64 m groß ist, 208 kg wiegt und in einem keltischen Grab gefunden wurde? Da in der Kunst fast alles erlaubt ist, störte man sich auch nicht daran, aus einem bemalten Weingefäß zu trinken auf dem ein Mann abgebildet ist, der auf seinem Penis eine Trinkschale balanciert. Viele solcher Kuriositäten lassen einen staunen und verwundert mit dem Kopf schütteln.
Viele nackte Wahrheiten erwarten die Leser im folgenden Kapitel, in dem es um das Personal von Dionysos und die meist ausufernden Bacchanale geht. Nymphen, Satyre, Putten, Eroten, Faune sowie betrunkene Silene in allen möglichen Situationen werden dargestellt. Wein- und Fleischeslust von Rubens und seinen Kollegen phantastisch ins Bild gesetzt. In unzähligen Stellen, so erfährt der Leser im letzten Kapitel, findet der Wein in der Bibel Erwähnung. In diesem Büchlein wird dies durch wunderbare Geschichten und Bilder dokumentiert. Ob Noahs Trunkenheit, die Geschichte von Lot und seinen Töchtern, die Hochzeit von Kana oder das wohl berühmteste Beispiel, das Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern, in dem der Wein neben dem Brot letztlich als symbolisches Bindeglied zwischen Mensch und Gott versinnbildlicht wurde. Daneben zeigen viele Gemälde wie „Christus in der Kelter“ oder „Maria mit dem Kinde und der Weintraube“ u. v. a. den Stellenwert des Weins im Christentum.
Ich habe dieses Büchlein mit Lust verschlungen und konnte es kaum erwarten, die Seiten umzublättern. Diese Mischung aus umfassendem, aussagekräftigem Bildmaterial, humorigen Bemerkungen und geschichtsträchtigen Texten ist einfach genial. Wein einmal ganz anders. Pralles Leben, tiefe Sinnlichkeit. Die Würdigung des Weins als eines der schönsten Kulturgüter der Menschheit. Dieser Streifzug in die griechische Mythologie, durch die berühmtesten Museen der Welt, zu antiken Stätten ist interessant, lehr- und aufschlussreich. Eine mehr als amüsante Geschichts- und Kulturstunde. Ein Lesespaß, egal ob mit oder ohne Wein.
Horst Kröber, Kippenheim
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
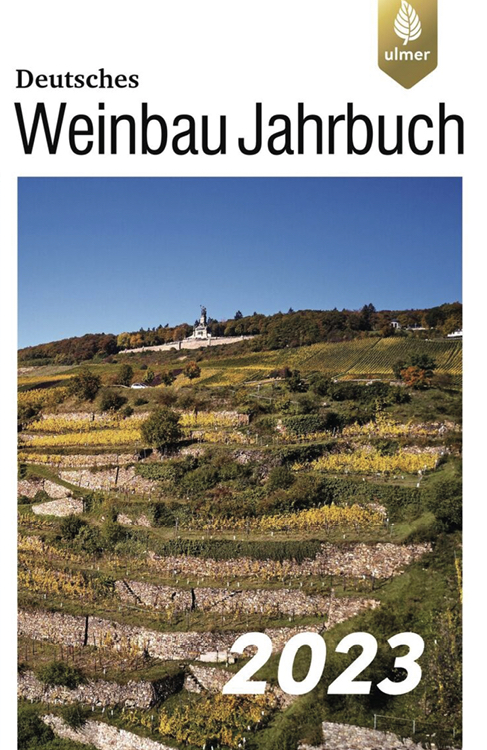
- Ertragsrebflächen 2021
- Wein und Mosternte 2021
- Weinerzeugung Weißwein 2021
- Weinerzeugung Rotwein 2021
- Keltertraubensorten in Deutschland
- Prüfstellen für die amtliche Prüfung der Qualitätsweine und Sekte
- Weinbau-Einrichtungen des Bundes und der Länder
- Weinbau-Einrichtungen des deutschsprachigen Auslandes
- Deutschsprachige Weinbruderschaften
- Weinmuseen in Deutschland
- „Jean-Louis Berlandier, ein fast vergessener Naturforscher von Mexiko und Texas mit einem entscheidenden Beitrag zur Rettung des europäischen Weinbaus vor der Reblaus“ von Prof. Dr. Ernst Rühl, Geisenheim
- „Klimawandel im Luxemburger Weinbau – Ein Blick auf die letzten fünf Jahrzehnte“ von Dr. Daniel Molitor, Mareike Schultz und Dr. Jürgen Junk
- „In vino veritas? Weinproduktion und Weinfälschung in Russland im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert“ von Prof. Dr. Lutz Häfner, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Universität Bielefeld
- „70 Jahre Ausschuss für Technik im Weinbau“ von Christian Reinhold, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Schilling, Klaus: Baumtrotten – Kulturerbe und Jahrhundertzeugen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. AS Verlag Zürich 2023, 220 Seiten. ISBN 978-3-03913-0 32-0. 56,00 Euro. 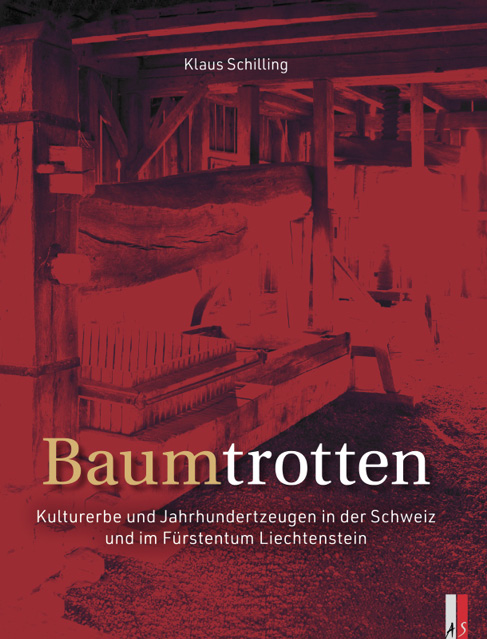
Der Betrachtung des Buches sei erklärend vorausgeschickt: Trotte ist eine regionale Bezeichnung für eine Kelter. Bei Baumtrotten wurde der Pressdruck auf die Maische über einen meist mächtigen Baumstamm als Hebel ausgeübt. Mit Hilfe beweglich angehängter Gewichte und die Hebelwirkung verstärkender Keile konnte der Druck gesteigert werden. Baumkeltern waren in Deutschland vor allem in den Weinbaugebieten östlich des Rheines in Baden und Württemberg verbreitet. Die noch erhaltenen sind Blickfänge in den großen Kelterhäusern von Weinmuseen. Sie waren meist im Besitz der Landesherren und der Klöster und dienten auch zum Eintreiben des Zehnten als Steuer.
Schon vor dem Blättern in dem großzügig gestalteten Bildband denkt man an uraltes Handwerk. In der Einleitung werden Ursprung, Aufbau und Funktion der Baumtrotten erklärt. Im Hauptteil sind die Keltern in Wort und Bild nach Gebieten und Orten gegliedert dargestellt. Ihre Erhaltung reicht von „Sicherung erforderlich“, über Mittelpunkt von Weinmuseen oder Nobelgaststätten bis hin zu Trotten, auf denen noch „historische“ Weine gepresst werden. Erstaunlich ist die große Anzahl noch erhaltener Exemplare, obwohl der Autor das Problem ihrer Erhaltung mit den Worten: „Augenweide oder platzraubender ‘Steh im Weg’?“ ausdrückt. Dargestellt sind die Keltern als Foto oder Zeichnung, zudem die Kelterhäuser. Besonders die Nahaufnahmen wichtiger Funktionsteile erwecken Respekt vor der Kunst der Handwerker vor der Einführung moderner technischer Hilfsmittel. Im Begleittext zu den Bildern wird auf die Geschichte und Funktion der Trotten eingegangen. Neben den Traubenkeltern werden auch besondere Geräte aus den Weinmuseen vorgestellt, zum Beispiel eine Presse zur Herstellung von Briketts aus Trester zum Heizen (Seite 179 und 184).
Der Anhang ergänzt den großartigen Bildkatalog mit der Vorstellung der Forscher, die über die Trotten arbeiteten, mit Literaturnachweisen und Adressen. Für die deutsche Weingeschichte ist im Anhang die Abbildung auf Seite 227 von Bedeutung. Die dargestellten Obst- und Beerenpressen wurden in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufig, unter anderem aus Südtirol zur Dekoration nach Deutschland gebracht und als Theken in Gaststätten oder Weinprobierstuben eingebaut. Nun werden manche schon als autochthon für die neue Heimat angesehen. Ergänzend zu den Ausführungen betreffend mechanischen Horizontalpressen auf Seite 22 sei erwähnt, dass Diderot bereits 1751 horizontal arbeitende Keltern beschrieben hat. Eine wurde 1833 von Bronner unter Kallstadt beschrieben. Sie hießen damals „Sargkelter“. Unterschlagen möchte ich nicht den Hinweis auf die Schrift Nummer 97 der „Schriften zur Weingeschichte“ von Gerhard Troost: „Keltern“, die umfassend über ihre Wirkungsweisen und Geschichte informiert.
Insgesamt kann der Band „Baumtrotten“ als wichtige Darstellung von Denkmälern der Weinkultur, des Weinbaus und des Handwerks bezeichnet werden. Er kann bei der Planung von Reisen Weinfreunden helfen, verborgene weinhistorische Schätze aufzufinden. Auch ohne Reise glaubte ich mit Freude im Buch den Geruch uralten Eichenholzes zu riechen.
Fritz Schumann, Neustadt an der Weinstraße
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Pfister, Christian und Wanner, Heinz: Klima und Gesellschaft in Europa. Haupt Verlag, Bern 2021, 424 Seiten. ISBN 978-3-258-08182-3 (E-Book 978-3-258-48182-1). Print-Version: 49,00 Euro, E-Book: 39,99 Euro. 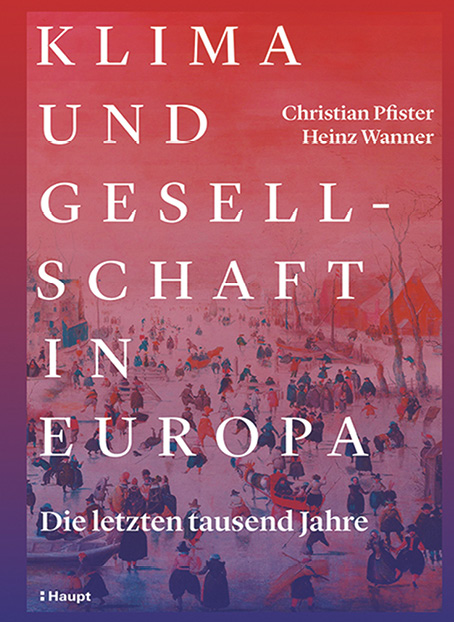
Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf menschliche Kulturen werden in dem Buch von Vertretern zweier unterschiedlicher Wissenschaftskulturen untersucht und dargestellt. Einmal aus der Perspektive der Naturwissenschaften (Christian Pfister), insbesondere der Klimatologie, und zweitens aus dem Blickwinkel der Geistes- und Sozialwissenschaften, insbesondere der Umwelt-Geschichte (Heinz Wanner). Die beiden Wissenschaften verfolgen unterschiedliche Ziele, sie haben ihren eigenen Denkstil und verwenden unterschiedliche Darstellungsweisen. Naturwissenschaftler erklären, wie natürliche Systeme funktionieren, während Historiker Geschichten von Menschen erzählen, die sich mit den Auswirkungen von Witterung und Klima befassen. Das Buch ist als Synthese zwischen einem naturwissenschaftlichen und einem sozialwissenschaftlichen Ansatz konzipiert. Ein faszinierender Ansatz, wobei viele benutzte Beispiele aus beiden Sichtweisen es ermöglichen, das Verständnis für die Komplexität der Thematik Schritt für Schritt zu verbessern.
Die Darstellung ist in elf Kapitel gegliedert, die in Teilkapitel unterteilt sind, auf die Querverweise hinleiten. Einschübe unterbrechen den Faden der wissenschaftlichen Darstellung und bringen spezielle Themen mit persönlichen Bezügen ins Spiel. Das erhöht nicht nur das Verständnis, sondern auch den Lesespaß!
Hier kann nur auf einige Kapitel beispielhaft hingewiesen werden: Die Einführung (Kapitel 1) verdeutlicht die unterschiedlichen Perspektiven der Natur- und Geisteswissenschaften im Umgang mit der Klimafrage. Die bekannte Geschichte des Eismanns Ötzi in Kapitel 2 führt in die Klimageschichte des Holozäns ein. Die letzten 1.000 Jahre dieses Zeitabschnitts sind geprägt durch den Wechsel von kühleren und wärmeren Perioden, welche im 20. Jahrhundert in die anthropogen verursachte Erwärmung überleiten. Große Vulkanausbrüche in den Tropen beeinflussten sowohl das Klima als auch die Geschichte der Menschheit. Ein derartiger Vorgang wird in Kapitel 3 anhand des indonesischen Vulkans Tambora beschrieben, dessen Ausbruch 1815 die letzte große Hungersnot in West- und Mitteleuropa auslöste. Die Auswirkungen auf das globale Klimasystem und das regionale Klima und Wetter in Europa werden dargestellt.
Kapitel 4 und 5 widmen sich der Geburt der Klimawissenschaft und der Rekonstruktion des vergangenen Klimas aus Proxydaten, wie zum Beispiel Jahrringanalysen, Eisbohrkernen, Seesedimenten, Stalagmiten, Gletscher und Baumgrenzen. Hinzu kommt die Auswertung von Archiven der Klöster, Kirchen, Güter etc. wie Zehntabgaben, Entwicklung der Reben, Weinlesedaten etc. Der Witterung des Sommerhalbjahrs im Lichte des Weinbaus ist ein eigenes Unterkapitel gewidmet. Kapitel 6 beschreibt zunächst die räumliche Dynamik des heutigen Klimas in Europa. Danach wird, basierend auf Daten aus Archiven der Natur, die Entwicklung des Klimas während der letzten 1.000 Jahre skizziert. In den Kapiteln 7 und 8 werden die jahreszeitlichen Temperaturen in West- und Mitteleuropa bis zum Übergang zur markanten Erwärmung in den späten 1980er-Jahren beschrieben, wobei ein besonderes Augenmerk den Extremen gilt. Das Klima des Hochmittelalters von 1000 bis 1300 n. Chr. umfasste ein kaltes 12. Jahrhundert und ein anschließendes sommerwarmes 13. Jahrhundert. In Kapitel 8 wird die nordhemisphärische Kleine Eiszeit, die vom 14. bis ins frühe 20. Jahrhundert andauerte, beschrieben. All diese klimatischen Veränderungen schlugen sich auf die Entwicklung des Weinbaus und auf die Quantität und Qualität der Weinernten nieder. Das Kapitel 9 verlagert den Ausgangspunkt der Betrachtung vom Klima zur Bevölkerungsentwicklung, was bedeutet, dass neben Wetter und Klima Kriege und Epidemien als Einflussgrößen in den Blick genommen werden. Das Buch schließt mit einer Übersicht über das europäische Klima des letzten Jahrtausends und dem Übergang von der langsamen zur raschen Klimaerwärmung. Ein umfangreicher Anhang enthält detaillierte Quellenangaben, Literaturverzeichnis und ein kurzes, aber hilfreiches Stichwortverzeichnis.
Es ist ein imponierendes Buch, das die heutige dramatische Phase eines der großen Zukunftsprobleme unseres Planeten in den historischen Kontext stellt. Die 424 Seiten bieten dank der reichhaltigen Illustrationen mit 215 Abbildungen und Grafiken eine hochaktuelle und interessante sowie kurzweilige Lektüre. Wer das Glück hatte, den Vortrag von Prof. Pfister auf der Herbsttagung in Nierstein zu hören, wird mit der Lektüre des Buches Gehörtes vertiefen und viel Neues über die größte Herausforderung unserer Menschheit lernen, denn die Lösung der Klimaprobleme ist mehr als eine naturwissenschaftliche Herkulesarbeit, sie ist eine gesellschaftliche Mammutaufgabe, die mehr sozialen Sprengstoff enthält, als uns lange bewusst war.
Rudolf Nickenig, Remagen
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Patzwahl, Wolfgang: Wassermanagement und Bewässerung im Weinbau. Eugen Ulmer Verlag 2023, 190 Seiten. ISBN 978-3-8186-1271-9. 24,95 Euro. 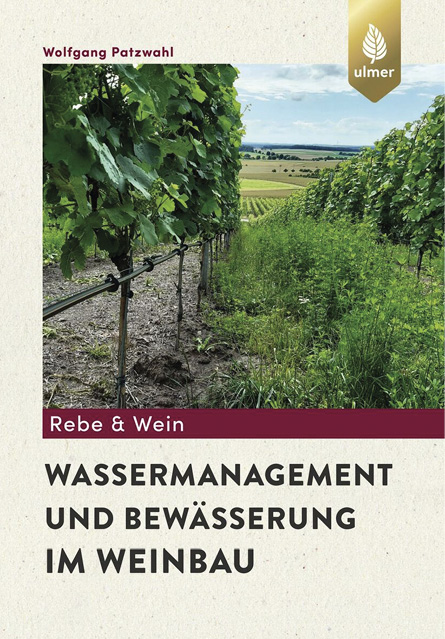
Kein anderes Thema brennt den Winzerinnen und Winzern in den letzten Jahren so unter den Nägeln: Mal gibt es Extremniederschläge und Überflutungen, dann wieder anhaltende Trockenheit – das Wassermanagement ist zur vielleicht größten Herausforderung des Weinbaus in unseren Breiten geworden. Wolfgang Patzwahl, ein erfahrener Weinbauexperte und Berater, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik und hat dazu auf vielen Tagungen referiert. Sein fundiertes Wissen hat er nun (erneut) in einem Buch niedergelegt. Übrigens hatte Gerhard Stumm vor 15 Jahren in der Mitteilung 1/2008 das damalige Buch „Bewässerung im Weinbau“ von Patzwahl lobend besprochen.
Im ersten Kapitel seines neuen Buchs geht Patzwahl zunächst auf die Rahmenbedingungen, sprich auf den Klimawandel und seine Folgen für den Weinbau sowie auf Anpassungsmöglichkeiten der Winzerinnen und Winzer ein. Als wichtige Klimaparameter werden Temperatur und Niederschlag erörtert. Intensiv schildert Patzwahl die Auswirkungen des Klimawandels auf Rebanlage und Wein: er präsentiert in Wort und Bild, in Tabellen und Fotos erkennbare Folgen für die physiologische Entwicklung der Rebe, für die Ertragsleistung, auf das Bodengefüge und Wasserhaltefähigkeit und zieht Hagel und Spätfröste in seine Analysen mit ein. Er zeigt die begrenzten Möglichkeiten der Anpassung auf den Klimawandel auf, unter anderem durch Sortenwechsel, Verlegung von Rebflächen, durch Einsatz von Bewässerung und anderes mehr.
Im zweiten Kapitel beschäftigt er sich dann mit den pflanzenbaulichen Grundlagen, also mit der Funktion des Wassers in der Pflanze, mit den Einflussfaktoren auf den Wasserhaushalt der Rebe sowie mit dem Wasserhaushalt in den Weinbergsböden und im gesamten Weinbergssystem. Was passiert in den Reben bei zunehmender Trockenheit? Wie reagiert die Pflanze darauf, wie kann der Winzer/die Winzerin in das komplexe System eingreifen? Im Hauptteil des Buches beschäftigt sich Patzwahl natürlich mit der Ausgestaltung des Wassermanagements von pflanzenbaulichen Maßnahmen, mit Bewässerungstechnik, Wasserbeschaffung und mit den Beziehungen zwischen Weinqualität und Bewässerung. Um nur einige Stichworte zu nennen: Wasserpotenzial, Wurzelhaarzone, Quantität und Qualität der Proteinbiosynthese, Kohlenhydratstoffwechsel, Anfälligkeit für Pilzinfektionen, Reservestoffeinlagerung und Frostresistenz. Es geht um die Einflussfaktoren auf den Wasserhaushalt der Rebe, um Reaktionsmuster von Reben bei Wasserverknappung und um den Einfluss von Bodenpflege und Begrünung. Die Betrachtungen drehen sich um das Wasser im Boden und um den Wasserhaushalt im System Weinberg. In weiteren Kapiteln geht es um das Wassermanagement im Weinbau, um zu empfehlende pflanzenbauliche Maßnahmen, um Bewässerungstechnik, um quantitative und qualitative Anforderungen an Bewässerungswasser sowie um den Zusammenhang zwischen Bewässerung und Weinqualität. Das Spektrum der aktuellen Fragen wird an den Themen der weiteren Kapitel deutlich: Bewässerung und Düngung, Bewässerung zur Frostabwehr, Planung von Bewässerungsanlagen, Arbeitsaufwand, Kosten und Effizienz sowie ökologische Aspekte.
Das Buch ist fachlich fundiert und zudem in einer gut lesbaren Art und Weise geschrieben. Es ist gut strukturiert, reich illustriert (31 Farbfotos, 46 Zeichnungen und 31 Tabellen), umgesetzt mit einer ansprechenden Graphik. Lobend zu erwähnen ist auch ein umfassendes Literaturverzeichnis und ein umfangreiches Sachregister. Kurzum: ein hochaktuelles und sehr empfehlenswertes Buch!
Rudolf Nickenig, Remagen
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Lucand, Christophe: Le Vin des Nazis. Verlag Dunod, 336 Seiten. EAN / ISBN 978-2-10085-233-8. ca. 20,00 Euro. 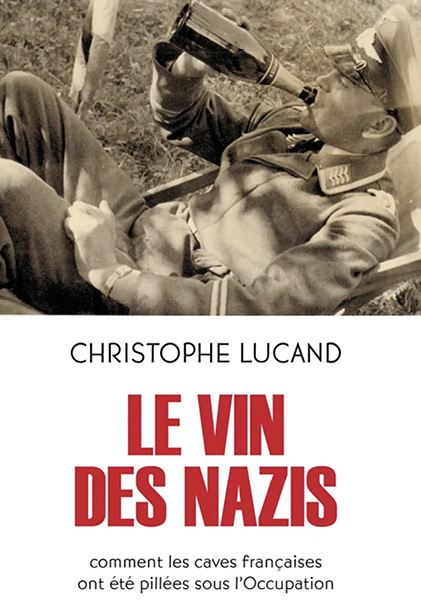
In seinem jüngsten Buch kommt Christoph Lucand wieder auf die Jahre 1940–44 und die Okkupation Frankreichs zurück, der er bereits 2017 eine Veröffentlichung gewidmet hatte. Der promovierte Historiker gehört in Frankreich zu den anerkannten Fachleuten auf diesem Gebiet, bekannt für akribische Auswertung von Archivmaterial. Das Cover-Photo eines aus der Flasche saufenden Soldaten und der Titel „Der Wein der Nazis“ führen in die Irre. Es geht gerade nicht um die Plünderung Frankreichs durch den Besatzer, sondern um die lukrativen Weingeschäfte französischer Kollaborateure und ihrer deutschen Partner.
So bizarr es erscheint: für die von Überproduktion geplagte Weinwelt Frankreichs war die Okkupation, rein kommerziell, erst einmal ein Segen. Goldgräberstimmung machte sich breit. Neue Akteure traten auf, denen die neu geschaffenen A.O.C.-Regelungen in die Hände spielten. Der eigentlich gut eingespielte Weinhandel kam ins Schwanken und es wurden für die französischen Weinregionen bevollmächtigte „Weinführer“ eingesetzt. Auch wenn Lucand es nicht thematisiert, so zeigen ihre Biographien, dass da ein eingespieltes Team am Werk war. Die „Weinführer“ waren absolut keine Unbekannten in Frankreich. Man arbeitete lange, oft schon seit Generationen zusammen. Die neue Situation war kein Bruch, sondern die Fortsetzung der guten Kooperation unter noch besseren Bedingungen. Auch die „Stunde Null“ am Ende der Besatzungszeit fällt aus. Man lud sich noch einmal zum Essen ein, verabschiedete sich freundlich und freute sich auf die baldige Wiederaufnahme der Geschäfte.
Kein Index hilft, den Überblick über die Fülle an Personen zu behalten, die der Text einführt – umso bedauerlicher, als der Leser auch nicht auf das Lexikon der „Persönlichkeiten der Weinkultur“ der GGW zählen kann: die deutschen Hauptakteure wie z. B. Joachim von Ribbentrop (im Nebenberuf Weinhändler, Deutschland-Vertrieb für Champagner Mumm und Pommery, Schwiegersohn von Otto Henkell), Otto Kläbisch (Generalagent von Lanson, Martell und Dubonnet, Geschäftsführer von Matheus Müller in Eltville, Schwager von Ribbentrop, Weinführer Champagne), sein Bruder Gustav Kläbisch (Weinführer Charente, wo die Familie eine Firma besaß), Friedrich Dörrer aus München und sein Nachfolger Adolph III Segnitz (Weinführer Burgund, Rhône, Provence), Heinz Bömers (Besitzer verschiedener Firmen in Deutschland und Frankreich, darunter Reidemeister & Ulrichs in Bremen, Weinführer Bordeaux) sind dort (noch) nicht zu finden.
Lucand zeichnet die Beziehungen der Besatzer zu den Konsumenten in den besten Kreisen der französischen Gesellschaft nach, aber auch den Weg der Massenware. Schließlich zeigt er, wie französischer Wein von einem begehrten Getränk zu einem strategischen Rohstoff der Kriegswirtschaft wurde und sogar destilliert im Antrieb von V1 und V2 landete. Der nationalsozialistische Durst nach Wein wird so eindrücklich geschildert, dass man glauben möchte, Deutschland sei ein Land ohne Wein. Der Stil des Werkes ist etwas pathetisch. Ein wohlwollendes Lektorat hätte hier Gutes tun können. Manche Stilmittel, die den Textfluss wohl lebendig machen sollen, wirken deplatziert. Die Charakterisierung deutscher Nazigrößen bleibt in Karikaturen und an Äußerlichkeiten hängen, die dem Verständnis nicht helfen – und gerade dem französischen Leser sicher nicht geholfen haben.
Nach der Lektüre bleibt der Eindruck, dass es sich eher um einen Ergänzungsband des 2017 erschienenen „Le Vin et la Guerre“ handelt, als um ein eigenständiges Werk. Dem Interessenten für diese Thematik sei hiermit nicht dieses, sondern beide Bücher empfohlen. Leider liegen die Arbeiten von Christophe Lucand bisher in englisch und japanisch, aber nicht in deutscher Sprache vor, was angesichts ihrer Bedeutung für die deutsch-französische (Wein-)Geschichte nicht nachzuvollziehen ist.
Den größten Gewinn aus diesen beiden Werken werden Forschende ziehen, die sich dem Thema in einer deutschen, deutsch-französischen oder europäischen Perspektive nähern. Allein die Auflistung der Aktenbestände und die Bibliographie geben so einem Projekt eine wertvolle Starthilfe.
Literatur:
Lucand, Christophe, Le Vin des Nazis. Collection Essais Français, Grasset, Paris 2023, 325 Seiten.
Lucand, Christophe, Le vin et la guerre. Comment les nazis ont fait main basse sur le vignoble français, Paris, Armand Colin, 2017, 448 Seiten.
Karoline Knoth, Meursault
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Küsters, Ernst: Mit Rotwein gegen Krebs – Wie die richtigen
Naturstoffe helfen. BoD – Books on Demand 2023, 286 Seiten. ISBN: 978-3-74481-660-1. 14,40 Euro.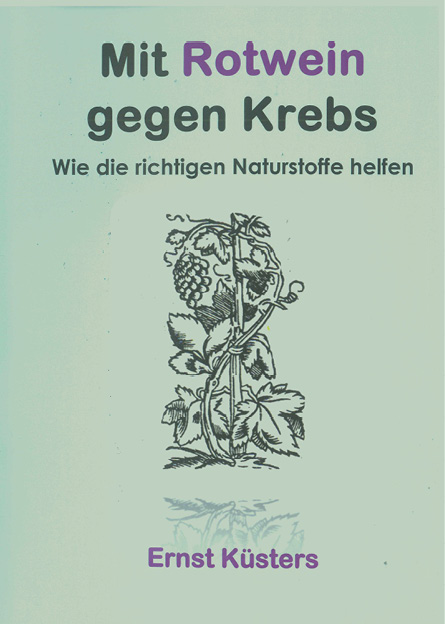
„Mit Rotwein gegen Krebs“ ist ein medizinisch-ernährungswissenschaftliches Fach- und Sachbuch über die antikanzerogenen Wirkstoffe im Wein. Es werden die wichtigsten Einzelstoffe und ihr pharmakologisches Potential kurzweilig vorgestellt und durch ein ausführliches Quellenverzeichnis gestützt. Der Leser sollte allerdings biologisch vorgebildet sein, um alles verstehen zu können.
Man merkt, dass der Autor über viele Jahre (1984–2020) Krebsmedikamente in der Pharmaindustrie miterforscht hat. Küsters stellt zu Beginn sachkundig und biochemisch umfassend die grundlegenden Mechanismen der Entstehung von Krebs dar. Dabei verweist er zunächst auf das diesbezüglich unterschätzte Zuckerabbauprodukt Methylglyoxal, das als mutagen und cancerogen gilt und fordert weniger Zucker – und mehr Rotwein – in unserer Nahrung. Dass das Überangebot an Zucker für viele Erkrankungen, einschließlich bestimmter Krebsarten verantwortlich gemacht wird, ist mittlerweile unumstritten.
Wein ist mehr als Alkohol. So gibt es über Säuren, wie Weinsäure, Gallussäure, Vanillinsäure, Kaffeesäure in der Tat gute Studien, die die Biochemie der Wirkung erklären. Ebenso werden die Polyphenole, wie Catechine und glykosilierte Flavonoide, wie das Malvidin, als bekannt antikanzerogen erwähnt.
Schwerpunkte des Autors sind die Polyphenole, allen voran das Resveratrol. Von ihm weiß man schon lange, dass es antikanzerogen und lebensverlängernd wirkt. Allerdings ist kritisch zu hinterfragen, wie viele Liter Wein man trinken müsste, aber wegen des Alkohols nicht sollte, um die pharmakologische Wirkung zu erzielen. Zwar gibt es die beschriebenen Wirkungen, die Frage ist, ob sie beim moderaten Konsum relevant sind.
Auf das Mengenproblem weist auch Küsters hin, nämlich dass das Resveratrol im „durchschnittlichen“ Wein nicht ausreicht und wirft daher die Frage auf, ob bestimmte Rebsorten unter diesem Aspekt empfehlenswert seien. Er konzentriert sich insbesondere auf Piwis als „richtigen“ Rotwein oder denkt sogar über „Kunstweine“ mit optimierter Zusammensetzung. Diese Überlegungen sind doch sehr problematisch. Natürlich findet man in Piwis, wie Regent oder Cabernet cortis, eine höhere Konzentration an Catechinen, Resveratrol oder Kaftarsäure, die allesamt als pharmakologisch wirksam gelten. Aber die Konzentration auf den „optimalen“ Wein (als Arzneimittel) ist nicht der richtige Ansatz für ein landwirtschaftliches Erzeugnis und Kulturgut. Vor allem sind derartige Ansätze im heutigen gesellschaftspolitischen Umfeld nicht kommunizierbar.
Der eigentliche Schwachpunkt: Küsters geht kaum auf kanzerogene Wirkungen des Alkohols per se bzw. dessen Oxidationsprodukt, auf das Acetaldehyd, ein. Diese Wirkungen sind wissenschaftlich ziemlich gut belegt und müssen sehr detailliert betrachtet und bewertet werden. Und es ist auch nicht zu übersehen, dass Alkohol im Wein um ein Vielfaches mehr vorkommt als die anderen Inhaltsstoffe. Die Summe der Einzelfaktoren ist eben doch was anderes als das Ganze. Kritisch ist auch anzumerken, dass der Titel nicht besonders glücklich gewählt ist – vor allem im Hinblick auf die alkoholpolitischen Gesamtwetterlage. „Wein als Medikament“ weckt negative Assoziationen und wird weder der Thematik noch der wissenschaftlichen Kompetenz des Autors gerecht. Denn unabhängig von den genannten Einschränkungen weist Küsters eine große Fachkenntnis auf, sowohl was die Inhaltsstoffe des Weines und ihr Potential anbelangen als auch Weinkenntnisse im Allgemeinen. Und deshalb lesenswert. Geschmack und Genuss – die eigentlichen Intentionen, Wein zu trinken – bleiben aber m. E. auf der Strecke.
Claudia Hammer, Oberwesel
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Archäologie in Deutschland, Ausgabe Februar/März 2023 mit dem Schwerpunktthema Wein, herausgegeben vom Verband der Landesarchäologien in der Bundesrepublik Deutschland, Verlag wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt, ISSN 0176-8522. 12,95 Euro.
Unter dem Titel „Wein – Vom Göttertrank zum Gaumenkitzel“ widmet sich die Zeitschrift Archäologie in Deutschland (AiD) in der Ausgabe 1/2023 schwerpunktmäßig dem Thema Wein. „Seit wann kennt man in Mitteleuropa Wein? Keramikfunden sieht man nicht an, welches Getränk einst damit konsumiert wurde. Unser Wissen über das Weintrinken in der Ur- und Frühgeschichte sowie der Antike beruhte lange Zeit auf Schriftquellen und bildlichen Darstellungen. Chemische Analysemethoden änderten dies: Sie eröffnen uns einen neuen Blick, der zunehmend Licht ins Dunkel des Einzugs der Rebe in die verschiedenen Kulturen bringt.“ So überschreibt Philipp W. Stockhammer vom Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität München das Schwerpunktthema Wein aus archäologischer Sicht. In sechs spannenden Beiträgen beleuchten Archäologen die Geschichte des Weins und beziehen hierbei neueste Erkenntnisse mit ein.
Maxime Rageot vom Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie desMittelalte rs an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen widmet sich der Frage „Was war im Gefäß?“ Mangels geeigneter Analysemethoden entzogen sich viele organische Materialien aus prähistorischen Epochen lange Zeit weitgehend der Forschung. Erst die Entwicklung relevanter chemischer Analyseverfahren und ihre Anwendung in der biomolekularen Archäologie ermöglichten die Extraktion und Bestimmung der chemischen Reste vergangener organischer Substanzen. In der frühkeltischen Zentralsiedlung Heuneburg in Baden-Württemberg wurde mediterraner Traubenwein gefunden. Rageot erläutert anhand dieser Funde das Potenzial von Rückstandsanalysen organischen Materials – sogenannte Biomarkeranalysen – bei der Untersuchung von Traubenprodukten, insbesondere Wein. Das Fallbeispiel zeigt eindrucksvoll, wie naturwissenschaftliche Analysen von Nahrungsrückständen ganz neuartige Einblicke in prähistorische Trinksitten und Handelsnetzwerke bieten können.
Manfred Rösch vom Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie an der Universität Heidelberg beschäftigte sich über einen langen Zeitraum hinweg mit Traubenkernfunden in Lehmgefachen historischer Gebäude und Pollenfunden in Seeablagerungen. In seinem Beitrag „Die Rebe und ihre Kultivierung“ erläutert er seine Ergebnisse, die es erlauben, Ausbreitung und Rückgang des Weinbaus im deutschen Südwesten seit der Römerzeit nachzuzeichnen. Diese Erkenntnisse stellen eine hervorragende Ergänzung zur Auswertung von Schriftquellen dar.
Carola Metzner-Nebelsick vom Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität München und Louis Nebelsick vom Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego in Warschau sahen sich Belege für Weinkonsum aus der Bronzezeit und der frühen Eisenzeit an. Sie kamen zum Ergebnis, dass die Vermittlung des Weintrinkens als Kulturpraxis über Norditalien im Zug vielfältiger Kontakte bereits in der ausgehenden Bronzezeit in den nördlichen Alpenraum gelangte. Außerdem gingen sie Rezepten für Trankopfer nach, die sich rekonstruieren lassen anhand von Gefäßrückständen von der Heuneburg, die neben Wein Rückstände von Bienenwachs, Milchprodukten, Getreide und tierischen Fetten enthielten.
Janine Fries-Knoblach vom Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität München analysiert unter der Überschrift „Edler Tropfen für edle Damen?“ bildliche, schriftliche und archäologische Quellen über Winzerinnen, Weinhändlerinnen und Weintrinkerinnen seit dem Beginn des Weinbaus. Wein war nicht nur Männersache!
In ihrem zweiten Beitrag „Rom und die Nordwestprovinzen“ beschreibt sie Weinbau und Weinkonsum in Rom, in Italien und in den römischen Provinzen. Hiervon zeugen Kelteranlagen, Weinlager, Weingefäße, Bildquellen und botanische Reste von Weinbau. Seit etwa 150 v. Chr. gibt es zudem Landwirtschaftsliteratur, in der Weinbau eine zentrale Rolle spielt.
Victoria Altmann-Wendling lehrt Ägyptologie am Institut für Altertumswissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Gemeinsam mit Philipp W. Stockhammer entstand unter der Überschrift „Ägypten, Anatolien und Griechenland in der Bronzezeit“ ein Überblick über die frühesten Nachweise von Wein in Eurasien und im Ostmittelmeerraum. Der Weinkultur gehen sie anhand von Darstellungen auf griechischer Keramik und ägyptischen Grabreliefs nach.
Die Texte sind spannend, gut lesbar und allgemeinverständlich aufgebaut sowie reich bebildert. Wertvoll sind die weiterführenden Literaturtipps, die eine tiefergehende Lektüre anregen. Das Heft sei allen empfohlen, die sich einen Überblick verschaffen wollen zu den aktuellen Methoden und Ergebnissen der archäologischen Forschung in Sachen Weingeschichte.
Christine Krämer
- Details
- Kategorie: Buchbesprechungen
Weinbruderschaft Mosel-Saar-Ruwer: Mosel-Anruf – Schriften der Weinbruderschaft Mosel-Saar-Ruwer e. V. Nr. 50–51. Verlag + Druck Linus Wittich KG, Forchheim, 2022. 246 Seiten; ISSN 18689647. 8,00 Euro*
[*zu beziehen über Sekretariat der Weinbruderschaft MoselSaarRuwer, Tel: 0171 8178394]
Der Mosel-Anruf, eigentlich gedacht als Tätigkeitsbericht der Weinbruderschaft Mosel-Saar-Ruwer, wurde 2022 aufgrund der Corona Einschränkungen als Doppelnummer 50 und 51 für die Jahre 2020 und 2021 herausgegeben. Da er neben den Aktivitäten der Weinbruderschaft einige interessante Beiträge weinfachlicher und weinkultureller Art enthält, soll hier darauf hingewiesen werden.
Die weinfachlichen Beiträge werden mit der Jahrgangsbeschreibung 2020 einschließlich Klimadaten eingeleitet. Daran schließt sich ein umfangreicher Beitrag zur Bedeutung von Standort und Unterlagsreben für RieslingKlone an der Mittelmosel an. In einer weiteren Abhandlung werden die „Anfänge der Züchtung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten (PIWIS) in Deutschland" und Nachbarländern dargestellt. Dabei wird auch die Vermarktung solcher Weine kritisch hinter fragt.
Drei bemerkenswerte historische und weinkulturelle Beiträge wurden abgedruckt.
Karl Adams hat „Blüte und Niedergang des Weinbaus in Stadt und Amt Linz am Rhein“, seiner Geburtsstadt, erforscht und nachgezeichnet. Der historischen Betrachtung folgt die Darstellung der Weingüter in Linz und Umgebung bis zum 19. Jahrhundert sowie die Blütezeit des Weinbaus in der Zeit von 1815 bis 1870. Als Ursachen für den Rückgang des Weinbaus nennt er die eingeschleppten Rebkrankheiten und für den Niedergang im 20. Jahrhundert die industrielle Entwicklung mit ihren bevorzugten außerlandwirtschaftlichen Alternativen für Arbeitskräfte.
Der Historiker und Geschichtsforscher Franz Irsigler geht der Frage nach, „Wie alt ist der bekannte Weinlagenname „Goldgrube“ in Wolf (Ortsteil von TrabenTrarbach) und wie könnte er entstanden sein“.
Die Forschungen und Aufzeichnungen des verstorbenen Historikers Karl-Josef Gilles nutzte sein Sohn Joachim, um den Artikel „Das „Saufbähnchen“ unterwegs zwischen Trier und Bullay" zu verfassen. Der Name „Saufbähnchen" kam im Volksmund deshalb auf, weil die Bahn ab 1907 in einigen Zügen einen Salonwagen einsetzte, in dem Wein der Region mit Bestellung beim Schaffner verkostet werden konnte. Schon Kurt Tucholsky hatte das Bähnchen während seiner Moselreise 1930 benutzt und ihm ein literarisches Denkmal gesetzt: „Wir soffen uns langsam den Fluß hinab, wir fuhren mit dem Saufbähnchen von Trier nach Bullay hinunter, und auf jeder dritten Station stiegen wir aus und sahen nach, wie es mit dem Weine wäre.“
Lesenswert sind auch drei weitere Aufsätze und zwar ein Beitrag von Ursula Schöffling über „Stein-Wein-Panorama-Erlebnisweg Fell – ein Ausflug in den Wein- und Schiefer-Ort", eine Darstellung von Claudia Müller „Ein neues Zuhause für Flora und Fauna", in der die Autorin den Bau eines Lebensturms für Insekten, Reptilien, Kleinsäuger und Vögel beschreibt und der Beitrag von Hans Adolf Polch „Skulpturenpfad im Erdener Treppchen – Art Brut, die Kunst von Laien und Menschen mit Beschränkungen".
Das breite Spektrum an interessanten Themen hält für jeden Leser sicherlich etwas bereit.
Gerhard Stumm