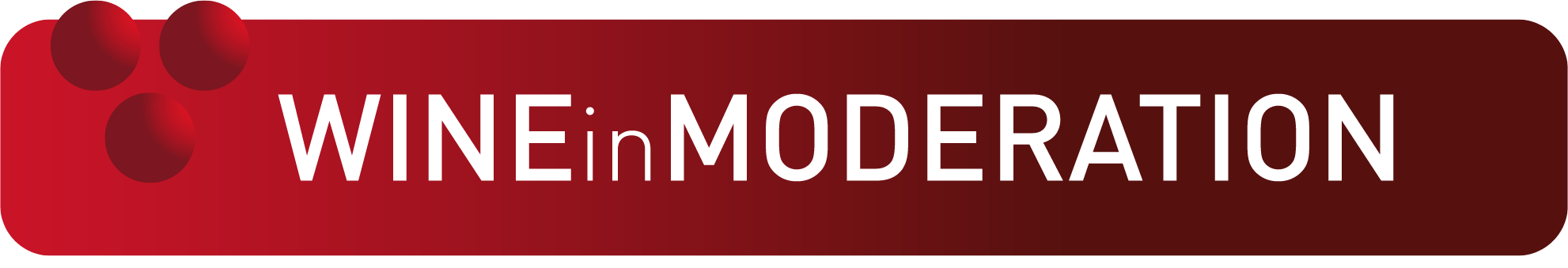Stoll, Manfred und Schultz, Hans-Reiner (Hrsg.): Das Deutsche Weinbaujahrbuch 2024. 256 Seiten, 26 Farbfotos, 41 farbige Zeichnungen, 25 Tabellen, kartoniert. ISBN 978-3-8186-2037-0. 14,95 Euro. E-Book (PDF) 11,99 Euro.
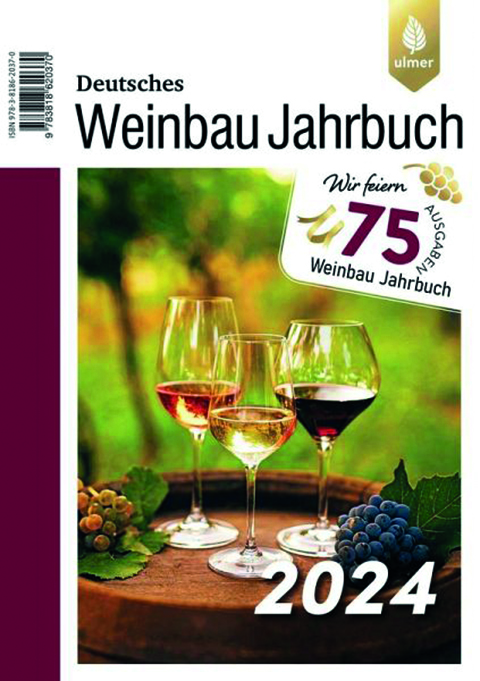 In diesem Jahr ist das 75. Deutsche Weinbaujahrbuch erschienen. Im Vorwort erinnern die heutigen Herausgeber Prof. Dr. Hans-Reiner Schultz und Prof. Dr. Manfred Stoll an die Leistungen ihrer Vorgänger, namentlich Dr. Bruno Götz, Dr. Waldemar Madel und Dr. Günther Schuft. Zutreffender Weise stellen die Herausgeber fest, dass das Deutsche Weinbaujahrbuch über all die Jahre stets durch fachlich wertvolle Beiträge geprägt war. Von Anfang an war es den Herausgebern ein wesentliches Anliegen, den Winzerrinnen und Winzern die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und Forschung aus den verschiedensten Gebieten in kurzen Aufsätzen zu vermitteln sowie Statistiken der Weinwirtschaft, Informationen über Rebschutzmittel, branchenrelevante Anschriften etc. an die Hand zu geben. Nicht zuletzt wurden immer wieder Beiträge aus dem Bereich Weingeschichte und Weinkultur publiziert, die für die Mitglieder unserer Gesellschaft von besonderem Interesse waren.
In diesem Jahr ist das 75. Deutsche Weinbaujahrbuch erschienen. Im Vorwort erinnern die heutigen Herausgeber Prof. Dr. Hans-Reiner Schultz und Prof. Dr. Manfred Stoll an die Leistungen ihrer Vorgänger, namentlich Dr. Bruno Götz, Dr. Waldemar Madel und Dr. Günther Schuft. Zutreffender Weise stellen die Herausgeber fest, dass das Deutsche Weinbaujahrbuch über all die Jahre stets durch fachlich wertvolle Beiträge geprägt war. Von Anfang an war es den Herausgebern ein wesentliches Anliegen, den Winzerrinnen und Winzern die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und Forschung aus den verschiedensten Gebieten in kurzen Aufsätzen zu vermitteln sowie Statistiken der Weinwirtschaft, Informationen über Rebschutzmittel, branchenrelevante Anschriften etc. an die Hand zu geben. Nicht zuletzt wurden immer wieder Beiträge aus dem Bereich Weingeschichte und Weinkultur publiziert, die für die Mitglieder unserer Gesellschaft von besonderem Interesse waren.
Auch in der 75. Ausgabe werden weinhistorische Themen aufgegriffen. Außerdem werden einige Beiträge veröffentlicht, die in einem Bezug zu den jüngste Tagungsthemen unserer Gesellschaft stehen. Lutz Häfner beschäftigt sich in seinem Aufsatz mit „In den Sand gesetzt? Der Weinbau auf Sandböden als Doppelstrategie gegen die Reblaus und die Verwüstung südrussländischer Steppengebiete im 19. und frühen 20. Jahrhundert“. Gerd Götz setzt sich mit dem Anbau und Anbauverboten von Hybrid- und Amerikanersorten in der Vorderpfalz zwischen 1890 und 1955 auseinander. Er hat seinen Beitrag mit „Vetter Kilians Erbe“ überschrieben. Im Nachgang zu unserer Regensburger Tagung weisen wir gerne auf den Beitrag von Wolfgang Rüby hin: „Der Baierwein, eine Renaissance?“ Eine lesenswerte Ergänzung zu unserem Tagungsthema Klimageschichte ist der Beitrag „Bringt die globale Erwärmung ein höheres Risiko für Spätfrostschäden?“ von Plückhahn, Brömser und Janssen. Gleiches gilt für die Veröffentlichung von Töpfer und Trapp: „Klimawandel und Nachhaltigkeit führen zu einem Wandel des Rebsortenspiegels“, ein Thema, das auch während der Frühjahrstagung am Mittelrhein diskutiert wurde. Nicht zuletzt möchten wir wieder auf die umfangreichen Informationen im Anhang des Weinbau-Jahrbuches hinweisen, darunter die Anschriften der Verbände, Organisationen, Einrichtungen des Bundes und der Länder sowie der deutschen Weinmuseen.
Rudolf Nickenig, Remagen
Fries, Oliver/Gerstenbauer, Lisa-Maria/Sonnleitner, Andrea/Spera, Stefan René (Hrsg.): Die vernakuläre Weinarchitektur Österreichs, Jahrbuch für Hausforschung in Österreich, Band 4 (2022). 352 Seiten; ISBN 978-3-9519895-3-2. Erhältlich zu einem Druckkostenbeitrag von 20,00 Euro (plus 6,00 Euro Versandkosten) bei Lisa-Maria Gerstenbauer (
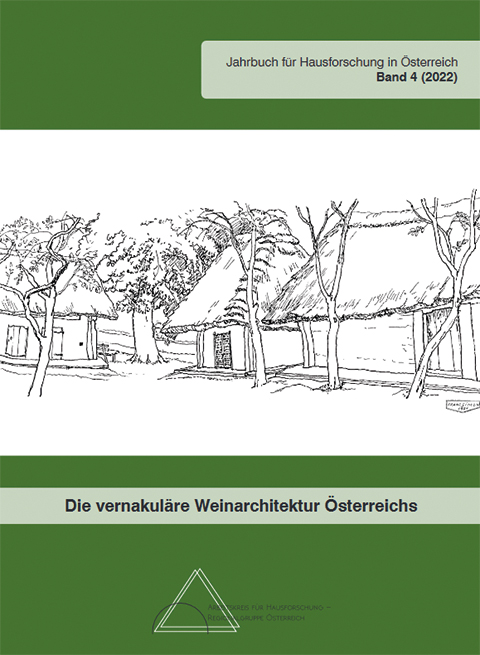 Der 4. Band des Jahrbuchs für Hausforschung in Österreich enthält auf rund 350 Seiten die schriftlichen Zusammenfassungen von Vorträgen, die im Rahmen der 2. Verbandstagung des Arbeitskreises für Hausforschung – Regionalgruppe Österreich zum Thema Die vernakuläre Weinarchitektur Österreichs vom 22. bis 24. Oktober 2021 im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf im Südburgenland gehalten wurden. Der Band fasst den aktuellen Forschungsstand zur bäuerlich-anonymen Baukultur im Kontext von Wein- und Obstbau zusammen und widmet sich insbesondere dem Themenkreis der Kellergassen. Dabei handelt es sich um ein nicht nur auf das heutige Niederösterreich beschränktes Phänomen bäuerlicher Zweckarchitektur, die in ähnlicher Ausprägung auch in anderen Weinbaugebieten Ostmitteleuropas zu finden ist.
Der 4. Band des Jahrbuchs für Hausforschung in Österreich enthält auf rund 350 Seiten die schriftlichen Zusammenfassungen von Vorträgen, die im Rahmen der 2. Verbandstagung des Arbeitskreises für Hausforschung – Regionalgruppe Österreich zum Thema Die vernakuläre Weinarchitektur Österreichs vom 22. bis 24. Oktober 2021 im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf im Südburgenland gehalten wurden. Der Band fasst den aktuellen Forschungsstand zur bäuerlich-anonymen Baukultur im Kontext von Wein- und Obstbau zusammen und widmet sich insbesondere dem Themenkreis der Kellergassen. Dabei handelt es sich um ein nicht nur auf das heutige Niederösterreich beschränktes Phänomen bäuerlicher Zweckarchitektur, die in ähnlicher Ausprägung auch in anderen Weinbaugebieten Ostmitteleuropas zu finden ist.
Das Thema der vernakulären, also traditionell gewachsenen Weinarchitektur bezieht alle Gebäude und baulichen Anlagen mit ein, die mit der Herstellung, Lagerung und Distribution von Trauben- und Obstwein auf dem Gebiet des heutigen Österreich und den angrenzenden Regionen der Nachbarländer in Beziehung stehen. Es sollen darunter rurale und anonyme Bauten verstanden werden, die nicht zum grundherrschaftlichen Eigenbetrieb gehörten. Dieser Ansatz schließt damit alle Anlagen geistlicher und weltlicher Herrschaft aus.
Aus dem Inhalt:
Oliver Fries/Thomas Schmid-Schwaigerlehner: Die vernakuläre Weinarchitektur Österreichs. Bilanz der 2. Verbandstagung des Arbeitskreises für Hausforschung – Regionalgruppe Österreich.
Gerold Esser: Die Kellergasse. Versuch einer bau- und siedlungstypologischen Gliederung.
Erich Landsteiner: Wirtschafts- und sozialhistorische Hintergründe der niederösterreichischen Kellergassen im ostmitteleuropäischen Kontext (16.–19. Jahrhundert).
Hubert Feiglstorfer: Lehm in der vernakulären Weinarchitektur in Österreich.
Erich Broidl: Funktionalität der Presshäuser in den Weinviertler Kellergassen und ihre Auswirkungen auf die Baustruktur.
Alexandra Knapp: Garben statt Reben. Zum Phänomen der Scheunenviertel in Deutschland.
Angelina Pötschner: Bauen für den Haustrunk. Das Kellerviertel Heiligenbrunn – ein Denkmalensemble im Herzen des Uhudlerlandes.
Johann Gallis/Albert Kirchengast: Das burgenländische Kellerstöckl: Mikrokosmos der Baukultur. Ein Anstoß aus gegebenem Anlass.
Astrid Kropf: Betrachtung des Presshauses aus Winten-Bergen und des Weinkellers aus Prostrum-Bergen im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf.
Maria Miggitsch: Das Kellerviertel Heiligenbrunn. Baudokumentation sowie historische und soziale Betrachtungen.
Veronika Plöckinger-Walenta: Weingartenhütten – unscheinbar, aber nicht unbedeutend.
Erich Broidl: Hauerlucken. Schutzbauten der Weinhauer im Löss.
Patrick Schicht: Winzerhäuser im niederösterreichischen Industrieviertel.
Oliver Fries: Die Presshausbauten der niederösterreichischen Kellergassen. Ein Bautypus im überregionalen Vergleich.
Elisabeth Rücklinger: Die Mostproduktion im niederösterreichischen Mostviertel, deren Presshäuser, Kellerstöckl und Kellerräume.
Hermine Ploiner: Die Kellergassen Etsdorf und Walkersdorf (Niederösterreich) – eine Quellensuche.
Marina Graser: Die Raschalaer Kellergasse: Entwicklungsprozess und Sanierung.
Wolfgang Galler: Keller und Kellergassen als Schauplatz soziokulturellen Lebens im südöstlichen Weinviertel.
Ronald Kurt Salzer: Die „Alte Geringen“ in Ketzelsdorf und die „Loamgstettn“ in Ameis – zwei niederösterreichische Kellergassen im wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Vergleich.
Václav Nečada/Jana Křivánková: Geschichte der Kellergasse von Tracht (Strachotín) in Südmähren (Tschechien).
István Vincze †: Ungarische Weinkeller.
Heidrun Schroffenegger/Hildegard Thurner: Tiefer Keller, Ansetz, Torgglkeller – Überlegungen zur Architektur der Weinkeller in der Umgebung von Bozen.
Oliver Fries/Lisa-Maria Gerstenbauer/Michael Grabner: Wie es kracht im Gebälk! Dendrochronologisch datierte Baumpressen in Niederösterreich: Ein kurzer Werkstattbericht.
Zusammengefasst: Das Handbuch enthält viele spannende Berichte – und man wird als Leser etwas traurig, dass wir nicht über ein entsprechendes Werk in Deutschland verfügen. Oder positiv gewendet: die Vorlage der v. a. österreichischen Kollegen sollte Anlass geben, über ein ähnliches Projekt bei uns nachzudenken.
Rudolf Nickenig, Remagen
Naser, Christian: Balthasar Neumanns Weinhändlerschloß. Das Zeller Palais als Kristallisationspunkt der wirtschaftsgeschichtlichen Bedeutung der fränkischen Weinhändler im 18. Jahrhundert. 2 Bände, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2022. ISBN 978-3-8260-7538-4. 88,00 Euro. 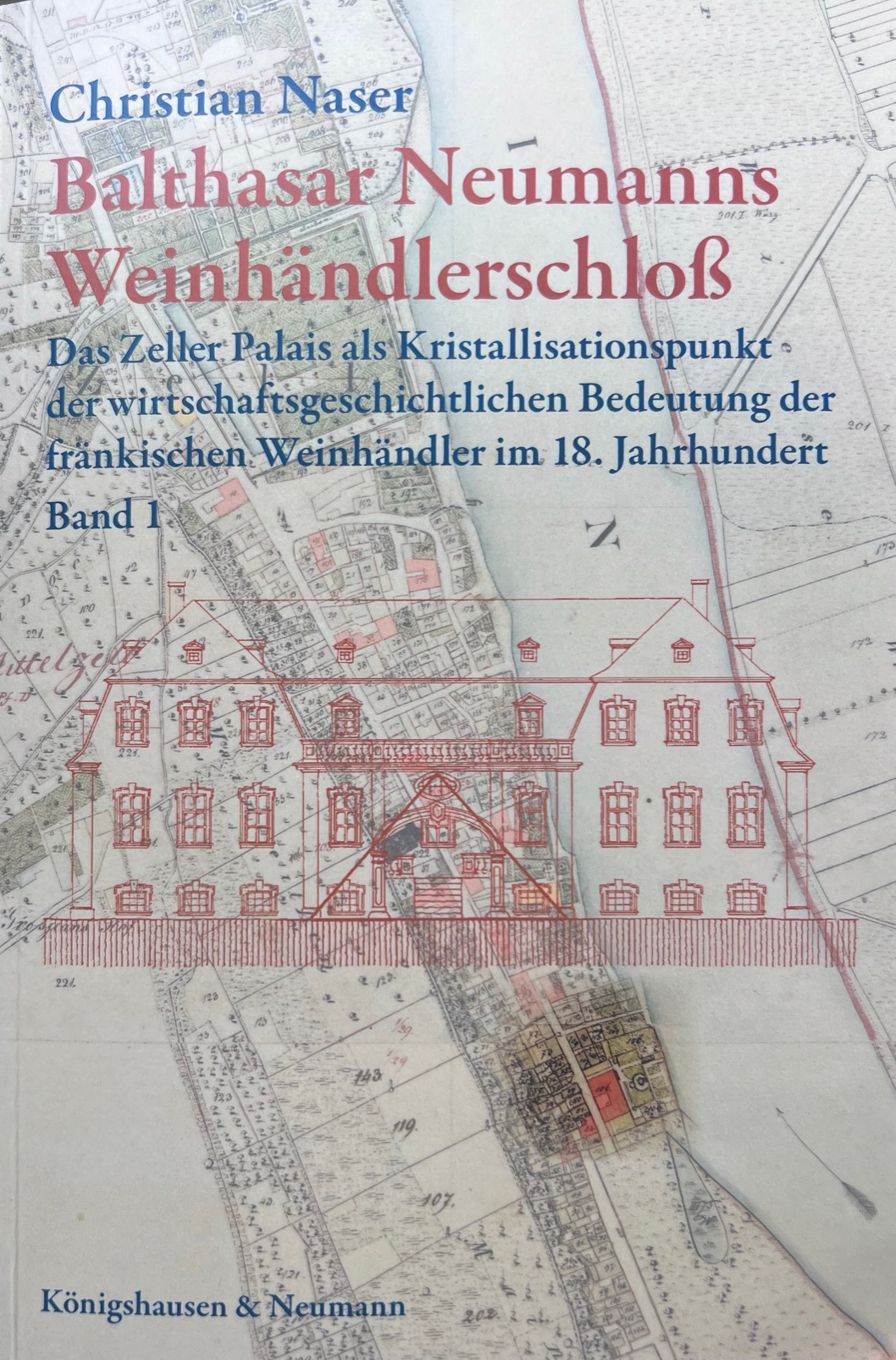
Einige werden sich erinnern: Anlässlich der Herbsttagung 2017 der Gesellschaft für Geschichte des Weines in Wertheim besuchten wir in Gerlachsheim das barocke Palais der Weinhändlerfamilie Buchler. Dr. Christian Naser hielt dort einen Vortrag zur Geschichte der fränkischen Weinhändler im 18. Jahrhundert. Naser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Philologie in Würzburg. Seine Beschäftigung mit den Weinhändlern und ihren Häusern entspringt vor allem bürgerschaftlichem Engagement: Es geht Naser darum, durch architekturhistorische Forschung kulturelles Erbe sichtbar zu machen, es in einen größeren wirtschaftsgeschichtlichen Kontext zu stellen und damit letztlich zur Erhaltung der Denkmäler beizutragen. Bereits 2012 hatte sich Naser in einer Publikation mit dem Zeller Weinhändlerpalais beschäftigt, das der berühmte Barockbaumeister Balthasar Neumann 1744 für den Weinhändler Andreas Wiesen ausführte. Nun hat er eine deutlich erweiterte Fassung vorgelegt.
Naser hat den 450 Seiten umfassenden Textteil in fünf Hauptkapitel gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Zeller Weinhändlerfamilien, ihrem Aufstieg, ihrer Bedeutung am Markt und ihrem Niedergang. Die fränkischen Weinhändler waren im Territorium des Hochstifts Würzburg im 18. Jahrhundert ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, ihr Aufstieg begann nach dem Pfälzer Erbfolgekrieg. Durch taktisch arrangierte Heiratsverbindungen entstanden mächtige Kartelle. Rund 30 fränkische Weinhändler hatten ihre Tätigkeit Anfang des 18. Jahrhunderts nach Frankfurt ausgedehnt, wo sie Dependancen unterhielten und den Weinmarkt dominierten und kontrollierten. In ihren fränkischen Heimatorten errichteten sie repräsentative Wohn- und Firmensitze. Die Familien der Zeller Weinhändler legten zunächst als Ziegelhändler und Schiffleute den Grundstock für ihr Vermögen. Das Hochstift Würzburg bot im 18. Jahrhundert mit seiner starken Bautätigkeit entsprechende Verdienstmöglichkeiten. Zell wiederum wies günstige Bedingungen für den überregionalen Weinhandel auf. Ausschlaggebend war die direkte Nähe zum Fluss als Transportweg, der Ort lag an einer Furt und am Knotenpunkt mehrerer bedeutender Verkehrswege und bot eine durch Quellen gespeiste Frischwasserversorgung. Innerhalb eines Zeitraums von etwa hundert Jahren, zwischen 1692 und 1794, entstanden in Zell zahlreiche Weinhändlerpalais, von denen 18 bis heute erhalten sind. Besonders markant sind die Jahre 1741 bis 1751, als parallel zum barocken Umbau des Klosters Oberzell die fünf größten Palais errichtet wurden. Obwohl sie vielfach umgenutzt wurden, prägen die Gebäude den Ortskern und sind von außerordentlicher Bedeutung für das Verständnis der Wirtschaftsgeschichte Zells und Frankens.
Der ausführliche zweite Hauptteil ist der Baugeschichte und der Architektur des Neumann‘schen Palais gewidmet. Die zwischen 1741 und 1744 errichtete Dreiflügelanlage, ein schlossartiges Gebäude mit Geschäfts-, Repräsentations- und Wohnräumen, eigener Anlegestelle und figurengeschmücktem Terrassengarten, verfügte über ein zweistöckiges Kellerensemble mit fünf um einen Ehrenhofkeller gruppierten Gewölbekellern. Zur Weinerzeugung werden große Mengen an frischem Wasser benötigt, eine eigene Wasserversorgung war also essenziell. Naser kann eindrücklich zeigen, dass die Quellen am Zeller Berg ein wichtiger Standortfaktor waren. Sie wurden durch Quellenfassungen und Brunnenkammern nutzbar gemacht, wovon das ausgeklügelte, heute noch funktionsfähige Wasserkanal- und Drainagesystem unter dem Zeller Schloss zeugt.
Im dritten Kapitel werden dem Zeller Schloss sechs palaisartige Weinhändlergebäude in Franken gegenübergestellt, im vierten Teil liefert Naser eine Inventarisierung der weiteren 17 in Zell erhaltenen Weinhändlerhäuser. Anhand dieser Vergleiche kann Naser das typische Raumkonzept eines Weinhändlerpalais aufzeigen: Produktion, Lagerung, Kontor, repräsentative Räume mit Festsälen und Wohnen unter einem Dach. Ein ausführlicher Quellenteil im fünften Kapitel sowie 220 Abbildungen in Band 2 ergänzen die Ausführungen.
Nasers quellengesättigte Studie ist an der Schnittstelle zwischen Weingeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Kunstgeschichte und historischer Bauforschung angesiedelt. Die Darstellung ist wegen der Komplexität und Vielzahl an Quellenbelegen nicht immer leicht zu lesen, die zentralen Aussagen werden in den jeweiligen Abschnitten jedoch in kurzen Zusammenfassungen verständlich auf den Punkt gebracht. Grundlagenforschung ist arbeitsintensiv, und gerade hierin liegt der hohe Verdienst dieser Studie. Die erhaltenen Weinhändlerhäuser in Zell wurden im Laufe der Jahrhunderte vielfach umgenutzt, stehen teils leer oder sind dem Verfall preisgegeben. In anderen fränkischen Weinbaugemeinden sind sie ganz verschwunden. Christian Nasers Buch liefert wichtige Bausteine, um dieses einzigartige kulturelle Erbe zu begreifen und ist ein Plädoyer dafür, es erlebbar zu machen und zu erhalten.
Christine Krämer, Stuttgart
Junglas, Wolfgang: Weinorte im Rheingau/Entdecken – Entspannen – Entkorken. Droste Verlag, Düsseldorf 2023. Paperback, 168 Seiten; ISBN 978-3-7700-2422-3. 16,00 Euro. 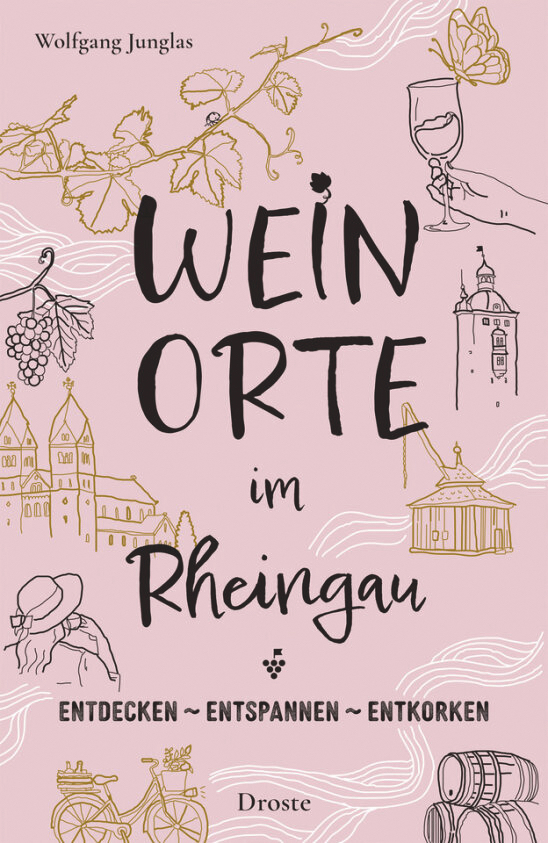
Die Gesellschaft für Geschichte des Weines plant, ihre Frühjahrstagung 2025 im Rheingau zu veranstalten. Wer sich rechtzeitig darauf vorbereiten will, dem sei dieses Buch des bekannten Fernsehschaffenden empfohlen. Der Autor ist im Rheingau zu Hause und wohnt mit seiner Familie direkt an den Weinbergen. Um die kümmert er sich als Präsident der Deutschen Weinpublizisten (Weinfeder e.V.) und der internationalen Weinjournalisten (FIJEV) auch beruflich. Er veröffentlichte bereits zahlreiche Gastronomieführer und produzierte bekannte TV-Sendungen wie „Johann Lafer kocht“ oder die „Wahl der deutschen Weinkönigin“.
Der gebürtige Eifelaner ist überzeugt: im Rheingau lässt es sich gut leben. Und dafür führt er in seinem Buch viele Argumente an. Er verfolgt dabei ein überzeugendes journalistisches und verlegerisches Konzept: Er stellt 76 „Weinorte“ vor, kurz, knapp und unterhaltsam auf einer Druckseite beschrieben, dazu jeweils ein ganzseitiges attraktives Foto. Auffallend, dass der Autor mit der Formulierung der Überschriften sehr stark auf weinkulturelle und weingeschichtliche Aspekte setzt: „Schlenderweinprobe im Kloster“ (Kloster Eberbach in Eltville), „Romantik pur erleben“ (Das historische Brentano-Haus in Winkel), „Riesenfass im Kunstkeller“ (Weingut Georg Müller Stiftung in Hattenheim), „Straußwirtschaft wie früher“ (Weingut Hanka in Johannisberg), „Weinkultur im besten Sinne“ (Keller & Kunst Kontor in Kiedrich), die Reihe an weinkulturhistorischen Aufhängern, die Junglas bedient, um seine Lieblingsorte anzupreisen, ließe sich fortsetzen.
Da Junglas zeigen will, dass sich im Rheingau gut leben lässt, kommt er an Empfehlungen für Weinrestaurants nicht vorbei. Das Spektrum ist groß: „Piratenbude am Fluss“ (Beachrestaurant Allendorf am Rhein), „Steinhaus für Gourmets“ (Das Graue Haus in Winkel), „Weinrestaurant klassisch“ (Restaurant zum Krug in Hattenheim) bis zu „Buntes Genussland“ (Y Wine & Kitchen in Eltville).
Der Autor zielt aber bewusst auch auf junge Weinfreunde, wenn er zum Beispiel folgende Empfehlungen gibt: „Chillen im Liegestuhl“ (Weinstrand Rüdesheim), „Kuscheln im Fass“ (Übernachten im Rheingau 524 in Geisenheim), „Jung und kreativ“ (Weingut Jung-Dahlen in Erbach). Natürlich dürfen touristische Empfehlungen nicht fehlen: „Weinwandern im Welterbe (Wander-Guru Wolfgang Blum), „Winzerhof für Wohnmobile“ (Weinhof Martin in Erbach), „Immer der Flasche nach“ (Flötenwanderweg in Oestrich), „Unterwegs zu Weinmühlen“ (Mühlenwanderweg im Elsterbachtal), „Auf zum Pfiffchenlauf!“ (Rheingausport in Oestrich), usw.
Natürlich beschäftigt sich Junglas nicht nur mit Wein, auch der Sekt kommt nicht zu kurz: „Hier prickelt der Rheingau“ (Sekt- und Weinkellerei Reuter & Sturm), „Prickelndes Weinhotel“ (Wein- und Sekthaus F. B. Schönleber in Mittelheim), „Oranger Sekt-Adel“ (Sektmanufaktur Schloss Vaux in Eltville), „Sektprobe über den Dächern“ (Bachmanns Wein+Kultur in Eltville), „Winzersekt aus Erster Lage“ (Wein- und Sektgut in Hattenheim).
Junglas entführt die Leser zu den unterschiedlichsten Weinorten, bunt gemischt und immer wieder überraschend: alle bekannten Weingüter, Klöster und Schlösser, aber auch Neueinsteiger, Gutsausschänke und Restaurants, Übernachtungsangebote, Weinprobiermöglichkeiten, farbige Weinerlebniswelten, Wanderempfehlungen, schönste Weinsichten, Weinfeste, Beratungsangebote, Wissenschaft, Nobles, Stylisches, Hippes, Traditionelles, bewährte und moderne Veranstaltungen. Ein kurzweiliges Brevier. Sehr zu empfehlen (insbesondere, Sie wissen schon, als Vorbereitung für die Frühjahrstagung 2025!).
Rudolf Nickenig, Remagen
Junglas, Wolfgang: Weinorte an der Mosel/Entdecken – Entspannen – Entkorken. Droste Verlag, Düsseldorf 2023. Paperback, 168 Seiten; ISBN 978-3-7700-2421-6. 16,00 Euro. 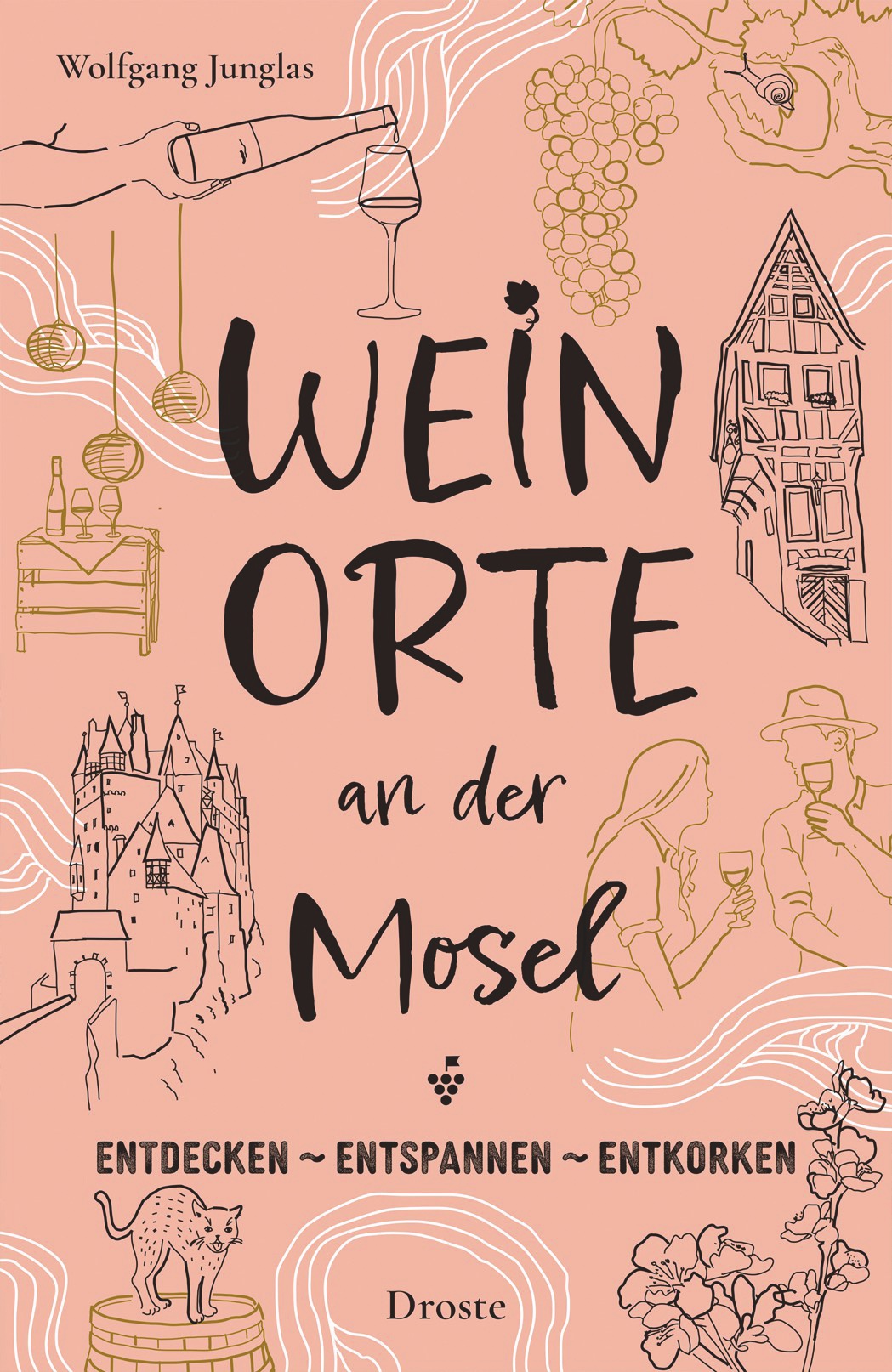
Der gebürtige Eifelaner Wolfgang Junglas ist nicht nur überzeugt, dass es sich im Rheingau gut leben lässt. Er bleibt auch seiner ersten Heimat verbunden, die mit Erinnerungen an Ausflüge in eine „lebensfreundliche, liebliche Welt“ der Mosel verknüpft ist. Über Jahrzehnte hat er die Entwicklung des Weinbaus und der Gastronomie in dem weltberühmten Tal sowie an Saar und Mosel journalistisch und weinverkostend begleitet. Nach seinem Eindruck befreit sich die traditionelle Touristenregion von ihrem verstaubten Image und punktet mit neuen Ideen. Alles wäre nichts, wenn zu dieser spektakulären Steillagenlandschaft nicht wieder herausragende Weinqualitäten angeboten werden – und davon ist er überzeugt. Er beobachtet, wie sich die jungen Moselaner und Moselanerinnen zwischen Weinfesten, Trachtentanzgruppen und modernen Weinevents neu erfinden. So fügen sich Landschaft, Menschen, Weine, wunderschöne alte und neue Architektur, innovative, aber auch bodenständige Gastronomie und Hotellerie, Freizeitangebote für Jung und Alt zu einem attraktiven weintouristischen Reiseziel zusammen.
Und so heißt es direkt im ersten Kapitel: „Bühne frei für die Weinkultur“ im Haus Waldfrieden in Alf, in dem die Kölner Szene (u. a. Wolfgang Niedecken) und der Frankfurter Raum stark vertreten sind. Die weiteren Empfehlungen umfassen das gesamte Spektrum von Weinkultur: Von „Hippe Weinbar an der Porta Nigra“ bis zu einem Besuch „in einer anderen Zeit“, im Jugendstil Hotel Bellevue in Traben-Trarbach. Wer sich für „Weinbau wie anno dazumal“ interessiert, dem wird von Junglas das Weinmuseum in Senheim empfohlen. Für die Wanderfreunde gibt es viele Möglichkeiten an der Mosel und der Autor spart nicht mit Tipps, die sich hinter neugierig machenden Überschriften verbergen: z. B. „Eidechse liebt Riesling“, ein Wein-Erlebnispfad in Bernkastel-Kues; „Let´s go Weinschnitzeljagd“ mit dem Weinhaus Kochan&Platz in Lieser oder „Team Wein unterwegs“, Weinwanderung mit den Weber Brüdern. Und natürlich finden sich bei diesen Weinwanderungen immer wieder tolle Aussichten, wie z. B. „der Blick der Helden“, die schönste Weinsicht in Lieser. Wer nicht das Hotelbett sucht, der hat mit „Schlafen wie im Fass des Bacchus“ eine bemerkenswerte Alternative. An der Mosel gibt es eine ganze Reihe von empfehlenswerten Übernachtungsmöglichkeiten, von Gästezimmern bis zu gediegenen Hotels. Junglas empfiehlt zum Beispiel als „Glücksort der Wein-Gastlichkeit“ den Winzerhof Gietzen in Hatzenport, das Weinhotel Deinhard´s in Bernkastel oder „das Hotel der Weinkönigin“ in Mertesdorf. Niemand braucht an der Mosel zu verhungern, das Angebot für jeden Geschmack und Geldbeutel ist vorhanden. Junglas empfiehlt zum Beispiel einen Besuch im „Wein-Tafelhaus Oos in Trittenheim“, wo man nicht nur auf der Terrasse, sondern auch in der Küche „den Sternen so nah“ ist. Gerne stimmt man dem Autor zu, „Fisch muss schwimmen“, sein Tipp für einen Besuch im Wein- und Fischhaus in Trier macht neugierig.
Längst ist der Erhalt der Steillagenlandschaft an der Mosel keine pure Männersache mehr. Junglas verdeutlicht dies an mehreren Beispielen, so an „Lenas Steillagen-Waden“, Weingut Endersfelder in Mehring, an der „Generation weiblich“ im Weingut Gindorf in Schweich, am Weingut Sandra Berweiler in Leiwen, wo es den „Wein der Frauen“ gibt. Natürlich verschweigt oder missachtet der Autor die berühmten Weingüter an Mosel, Saar und Ruwer nicht, die international bekannten Flaggschiffe, die Vor- und Immernochkämpfer für den guten Ruf des Rieslings und des einmaligen Terroirs. Und trotzdem ist nicht zu übersehen, dass es auch an der Mosel Schwierigkeiten gibt, alle guten Steillagen zu erhalten. Umso wichtiger sind ergänzende Projekte zum Rebenanbau, wie zum Beispiel „ein Weinberg duftet nach Lavendel“, der Razejunge Wingert in Lehmen lädt ein zum Besuch.
Junglas entführt die Leser zu den unterschiedlichsten Weinorten, zu bekannten Weingütern, Neueinsteigern, Gutsausschänken und Gaststätten, empfiehlt unterschiedliche Übernachtungsangebote, vielfältige Weinprobiermöglichkeiten, gibt Wanderempfehlungen, präsentiert schönste Weinsichten, Hippes und Traditionelles in bunter Mischung. In der Kürze liegt die Würze. Ein empfehlenswertes Brevier für alle Moseljünger und für die, die es werden wollen.
Rudolf Nickenig, Remagen